Schlagwort: diversität

Bild: Google DeepMind / Unsplash
10.11.2025 | Meena Stavesand
KI ist Teamsport: Warum wir alle mitspielen sollten
„Education is key“ – aber reicht Aufklärung allein? Bildungsexperte Max Landefeld vom Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS erklärt, warum KI ohne diverse Teams unvollständig bleibt und wichtige Perspektiven übersieht, was der EU AI Act bringen soll und weshalb KI-Kompetenz schon in der Schule beginnen muss. Das Interview ist ein Plädoyer für KI als Teamsport statt Tech-Monopol.
Mit der HAW Hamburg hat das Fraunhofer IAIS das Lernangebot „KI und Diversität“ erstellt. Warum das wichtig ist? Künstliche Intelligenz reproduziert unsere Vorurteile und genau daran müssen wir auf Entwicklungs- und Nutzungsebene arbeiten. Wie das aussehen kann, verrät Max Landefeld im Gespräch.

KI und Diversität
Um mit KI verantwortungsvoll umgehen zu können, bietet euch dieser Kurs ein Verständnis für KI-Konzepte, Biases, ethische Fragestellungen und Standards vertrauenswürdiger KI.
Wenn Sie Künstliche Intelligenz und Diversität hören, welche drei Begriffe kommen Ihnen in den Sinn und warum?
Max Landefeld: Mir kommt zuerst der Begriff „Spiegel“ in den Kopf – das mag etwas pathetisch klingen, aber KI zeigt uns relativ schnell, was in unseren Daten und damit auch in unseren Denkmustern steckt. Als Reflexionsinstrument sehe ich diese Technologie als sehr wertvoll an.
Der zweite Begriff, der direkt an das Thema Daten anknüpft, ist „Fairness“ beziehungsweise „Unfairness“. Viele Daten weisen Selection Bias auf – diskriminierende Muster finden sich in den Daten wieder und werden dann häufig unbewusst durch die Algorithmen reproduziert. Die Algorithmen selbst haben erst einmal keinen eigenen Wertemechanismus, was dann häufig zu unfairen Ergebnissen führt.
Als dritten Begriff denke ich an „Vertrauenswürdigkeit“ oder „Trustworthiness“. Dieser Bereich der Forschung setzt sich kritisch mit KI auseinander und fasst Initiativen und Ansätze zusammen – seien es technologische oder regulatorische Ansätze. Sie beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Einsatz von KI, die insbesondere zuverlässig, ethisch und sicher sein soll. Das sind die ersten Buzzwords, die mir in den Kopf kommen.

Bias (engl. für Verzerrung oder Voreingenommenheit) bezeichnet systematische Fehler oder Unausgewogenheiten in Daten und Algorithmen, die zu unfairen oder diskriminierenden Ergebnissen führen. Diese entstehen, wenn KI-Systeme mit historischen Daten mit gesellschaftlichen Ungleichheiten trainieren.<br><br>Beispiele: Recruiting-Software bevorzugte männliche Bewerber, Gesichtserkennungssysteme funktionieren bei hellhäutigen Personen zuverlässiger als bei People of Color, Kreditvergabe-Algorithmen benachteiligen Menschen aus bestimmten Wohngebieten.<br><br>Gegensteuern lässt sich durch vielfältige Entwicklungsteams, repräsentative Trainingsdaten und kontinuierliche Überprüfung der Ergebnisse.
Sie beschäftigen sich mit KI und Diversität. Gab es einen Schlüsselmoment, der Ihr Interesse oder Bewusstsein für verantwortungsbewusste und vielfältige KI besonders geweckt hat?
Landefeld: Ich arbeite seit mehreren Jahren im Bildungsbereich, und wenn ich ehrlich bin, sind es die Diskussionen mit Schülerinnen und Schülern, die mich besonders prägen. Sie berichten ungefiltert von ihren Ängsten, Vorbehalten und negativen wie positiven Erfahrungen mit KI. Ich kann also keinen genauen Termin nennen, aber die Debatten, die mich über die vergangenen Jahre begleiteten, haben mein Interesse und mein eigenes Bewusstsein für das Thema stark gefördert und gestärkt.
Was sind die Ängste der Schüler:innen?
Landefeld: Häufig befürchten sie, dass KI wie in einem Science-Fiction-Film – Stichwort Terminator – autonom die Weltherrschaft übernimmt. Das sind die extremen Gedanken. Einfachere Beispiele kennen sie von Instagram, TikTok oder aus Zeitungen: Systeme, die bestimmte Gruppen ausschließen, beispielsweise bei Bewerbungen für Jobs. Oder Chatbots, die regelmäßig schädlichen Input geben, aber auch Feedback, das irreführend ist und die Schülerinnen und Schüler verunsichert.
Hat sich das in den vergangenen Jahren verstärkt? Als ChatGPT rauskam, wurde KI quasi gesellschaftsfähig. Vorher war sie eher ein Thema für Fachleute. Haben sich die Gespräche verändert?
Landefeld: Die Besonderheit ist: Wir nutzen KI schon seit vielen Jahren, teils Jahrzehnten – häufig wissen wir das aber nicht. Es fängt bei den Empfehlungsalgorithmen von Social Media an, geht über Googles Page-Ranking-Algorithmus bis hin zur Face-ID am Smartphone oder Google Maps. Überall stecken Machine Learning und Deep-Learning-Algorithmen drin.
Mit ChatGPT hatten wir jetzt einen Game Changer: Mit einem Aha-Effekt bekommt man generischen Output und allen wird klar: Okay, das scheint ein KI-System zu sein. Die größte Herausforderung dabei ist das Thema Aufklärung. Wir sagen immer „Education is key“ – und da ist etwas dran. Wir sollten versuchen, KI-Kompetenzen zu schulen und im besten Fall in der Schule damit anfangen, wirklich aufzuklären. Das bedeutet nicht, dass jede:r Data Scientist:in werden muss – das sind die Fachleute, die sich mit der Algorithmik und der Konzeptionierung von KI-Systemen beschäftigen. Aber zumindest jede:r sollte ein grundlegendes Verständnis haben:
- Wie funktioniert so ein Algorithmus?
- Warum sind Daten wichtig?
Nur so können wir potenziell gefährliche Outputs wie Bias erkennen, reflektieren und einschätzen.
Neben der Aufklärung ist die Transparenz wichtig. Insbesondere wenn wir KI nutzen, wissen wir im Regelfall nicht, welche Daten ins Modelltraining geflossen sind. Da braucht es Transparenz – auch auf der Anbieterseite.
Gelingt das aktuell?
Landefeld: Aktuell gelingt es wenig bis kaum. Wir haben den EU AI Act, der derzeit sukzessive in nationales Recht überführt wird. Diese europäische KI-Regelung soll Abhilfe schaffen und insbesondere die Anbieter dazu verpflichten, ihre Systeme kritisch aufzubauen und zu prüfen. Auch hier spielt das Stichwort Vertrauenswürdigkeit eine große Rolle.
Wir in Europa haben große Hoffnungen, dass diese KI-Entwicklung auf europäischer Ebene zu unseren Gunsten beeinflusst wird und wir uns kritischer und selbstreflektierter damit auseinandersetzen. Wobei wir einschränken müssen: Es handelt sich um europäisches, nicht um internationales bzw. globales Recht.

Der AI Act (KI-Verordnung) ist ein umfassendes Gesetz zur Regulierung Künstlicher Intelligenz, das die Europäische Union (EU) 2024 verabschiedet hat. Die Verordnung wird derzeit schrittweise in nationales Recht überführt und soll 2026 vollständig in Kraft treten.<br><br>Das Gesetz teilt KI-Systeme nach ihrem Risiko ein: Anwendungen mit unannehmbarem Risiko wie biometrische Massenüberwachung werden verboten. Hochrisiko-KI in sensiblen Bereichen wie Bewerbungsverfahren, Kreditvergabe oder Strafverfolgung unterliegt strengen Auflagen. KI mit geringem Risiko wie Chatbots muss als solche gekennzeichnet werden. Für KI-Anbieter bedeutet das: Sie müssen offenlegen, welche Daten sie zum Training verwendet haben, Risiken dokumentieren und ihre Systeme auf Diskriminierung prüfen. Bei Verstößen drohen hohe Strafen. <br><br>Der AI Act gilt als wichtiger Schritt für vertrauenswürdige KI, betrifft aber nur den europäischen Markt – internationale Standards fehlen weiterhin.
Wie kann Diversität dazu beitragen, KI fairer und besser zu machen?
Landefeld: Diversität ist ein elementarer Schlüssel, weil sie Blickwinkel erweitert. Auf der einen Ebene bei der Entwicklung – das geht von der Datenauswahl bis hin zur Interpretation der Ergebnisse. Unterschiedliche Erfahrungen, kulturelle Hintergründe und Denkweisen können dabei helfen, Wissenslücken zu erkennen , Perspektivenvielfalt zu ermöglichen und damit gerechtere, vertrauenswürdige Systeme zu gestalten. Das ist die Entwicklungsseite, wo wir noch viel Potenzial haben.
Gleichzeitig müssen sich aber auch die Nutzenden damit auseinandersetzen – also diejenigen, die diese Systeme nicht selbst entwickeln, sondern sie tagtäglich anwenden. Auch sie müssen sich damit beschäftigen und beispielsweise den Output ihrer Chatbot-Anfragen kritisch prüfen.
Warum ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen – nicht nur Fachleute – ein Verständnis für KI und Vielfalt entwickeln?
Landefeld: Weil KI so allumfassend ist und alle Gesellschaften, alle Industrien berührt. Das betrifft insbesondere die private Nutzung zu Hause mit den sozialen Medien, aber auch die ganze Joblandschaft. Es wird keine Industrie geben, die langfristig nicht bedeutend von KI berührt wird und sich dadurch verändert.
Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns alle kritisch damit auseinandersetzen. Ein Kollege von mir sagt immer: „KI ist Teamsport.“ Das fasst es gut zusammen. Es ist eben nicht dieses „nerdige“ Informatik-Thema, mit dem sich nur die Data Scientists befassen sollen.
Denn selbst Data Scientists mit einem multikulturellen, diversen Hintergrund sind nicht zwingend repräsentativ für Gesellschaften. Es sind häufig doch die Akademiker:innen mit mathematisch-statistischem Hintergrund. Deswegen muss man sich – wieder diese Differenzierung – auf der Entwicklungsebene kritisch damit auseinandersetzen und ein grobes Verständnis auch für diese algorithmische Voreingenommenheit und Biases in KI-Systemen entwickeln, aber eben auch auf der Nutzungsebene.
Sie haben mit der HAW Hamburg am Fraunhofer IAIS ein Lernangebot zu KI und Diversität entwickelt: Was kann ich da lernen?
Landefeld: Wir befassen uns auf der einen Seite mit den Grundlagen: Was ist KI überhaupt? Woher kommt sie? Es gibt verschiedene Begriffe und Grundtechnologien, die in fast allen Systemen vorkommen – die erklären wir. Des Weiteren erklären wir das Thema Biases und welchen Bezug das zur Diversität hat. Wir zeigen auf, warum diverse Ansätze so wichtig sind. Dann schauen wir uns an, was auf regulatorischer Ebene passiert und was die europäischen Institutionen vorgeben – an Leitlinien, aber auch an Gesetzen wie dem EU AI Act. Zum Abschluss üben wir den kritischen und reflektierten Umgang mit solchen Tools, mit den Chatbots, die gerade sehr präsent in unserem Alltag sind.

KI und Diversität
Um mit KI verantwortungsvoll umgehen zu können, bietet euch dieser Kurs ein Verständnis für KI-Konzepte, Biases, ethische Fragestellungen und Standards vertrauenswürdiger KI.
An welche Altersgruppe richtet sich das Angebot?
Landefeld: Das E-Learning richtet sich an Menschen ab 16 Jahren aufwärts – insbesondere an Schülerinnen und Schüler, aber auch an Studierende der Hochschulen. Es ist ansonsten offen für alle. Wir freuen uns, wenn Menschen mit einem anderen Hintergrund, beispielsweise im Kontext der beruflichen Weiterbildung, sich damit auseinandersetzen. Demnach ist es auch kostenlos und frei verfügbar für alle. Sie bekommen dort einen schnellen Einstieg, wenn Sie sich mit dem Thema befassen wollen.
Wenn Sie in die Zukunft blicken: Was wünschen Sie sich für den gesellschaftlichen Umgang mit KI in einer pluralistischen Welt?
Landefeld: Ich fände es schön, wenn KI von diesem reinen Informatik-Thema weg kommt und als gemeinsames Gestaltungsprojekt verstanden und interpretiert wird. Denn es ist kein rein technisches Thema – es ist so bedeutsam und hat so viel Einfluss auf verschiedene Bereiche bei uns privat, aber auch auf der Arbeit. Im Zuge dessen – und das ist vielleicht sogar ein Appell, den ich formulieren möchte – ist es wichtig, dass wir KI-Kompetenzen aufbauen und dass dies strukturell gefördert wird. Das geht meines Erachtens schon in der Schule los, und zwar nicht nur im Informatikunterricht, sondern fächerübergreifend.
Dieser Ansatz sollte sich fortsetzen bis zur universitären Ausbildung und dann zur stetigen Aus- und Weiterbildung auch im Betrieb. Der Artikel 4 des EU AI Acts sieht genau das vor. Trotzdem haben wir noch viel zu tun in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, um diese Kompetenzen aufzubauen. Wichtig ist es allemal.
Über Max Landefeld

Max Landefeld arbeitet am Fraunhofer IAIS und koordiniert die Initiative AI4Schools. Diese widmet sich der Gestaltung von Bildungsangeboten rund um das Thema KI für Schulen. Er engagiert sich leidenschaftlich für die Entwicklung vertrauenswürdiger, nachhaltiger und niedrigschwelliger KI-Systeme.

Bild: Lukas S / Unsplash
31.07.2025 | Meena Stavesand
Vielfalt leben: Wie Empowerment und Bildung unsere Gesellschaft stärken
Hamburg feiert Vielfalt: Der Christopher Street Day (CSD) bringt am Wochenende Farbe und Botschaften für Gleichberechtigung in die Hafenstadt. Doch Pride ist mehr als ein Fest – es ist Erinnerung und politischer Auftrag in einem. Hinter der Feier steckt eine Geschichte, die uns bis heute lehrt, warum Empowerment so wichtig ist.
Regenbogenfarben überall in der Stadt: Am Sonntag ziehen wieder viele Menschen durch die Straßen Hamburgs, um ein Zeichen zu setzen. Für Toleranz, für Diversität, für eine gemeinsame Zukunft.
Klar ist aber auch: Vielfalt braucht Wissen. Wer die Geschichte von Stonewall kennt, die hinter dem CSD steht, begreift, warum die Paraden weltweit heute noch so wichtig sind. Bildung schafft dieses Verständnis – und gibt Werkzeuge an die Hand, um Diskriminierung abzubauen. Unser Lernangebot „Diversify!“ der HAW Hamburg unterstützt dabei, Perspektiven zu erweitern und Empowerment in die Praxis umzusetzen. Dazu gleich mehr.
Von Stonewall bis Hamburg – der Ursprung einer weltweiten Bewegung
Die Wurzeln reichen zurück ins Jahr 1969: In der New Yorker Christopher Street kam es in der Bar Stonewall Inn zu einer weiteren Polizeirazzia – doch diesmal wehrten sich die Gäste. Angeführt von mutigen Stimmen wie Stormé DeLarverie begannen mehrtägige Proteste. Diese Stonewall-Aufstände markierten den Beginn der modernen LGBTQ+-Bewegung und inspirierten Menschen auf der ganzen Welt.

It was a rebellion, it was an uprising, it was a civil rights disobedience—it wasn’t no damn riot.Stormé DeLarverie über die Stonewall-Unruhen
Nur zehn Jahre später fand auch in Deutschland der erste Christopher Street Day statt, nämlich in Berlin. Hamburg schloss sich ein Jahr später an. Seitdem ist der CSD hier ein fest verankerter Termin, der nicht nur gefeiert, sondern auch als politisches Signal verstanden wird.
Mehr Aufklärung für mehr Akzeptanz
Die Geschichte von Stonewall und der CSD-Bewegung ist mehr als nur ein Rückblick – sie ist eine Einladung zum Lernen. Bildung hilft uns, zu verstehen, warum diese Kämpfe geführt wurden und warum sie bis heute wichtig sind. Sie zeigt, wie tief Vorurteile in Gesellschaften verwurzelt sein können, und wie gezielte Aufklärung zu mehr Akzeptanz führt.
Ob in Schulen, Hochschulen, Medien oder am Arbeitsplatz – Bildung öffnet Türen. Sie macht deutlich, dass Vielfalt kein Trend, sondern ein fester Bestandteil einer gerechten Gesellschaft ist. Genau hier setzt Empowerment an.
Empowerment: Wohlbefinden und Sichtbarkeit stärken
Empowerment ist heute ein zentrales Element der Pride-Bewegung. Es geht darum, Menschen zu bestärken, die aufgrund ihrer Identität oder Orientierung immer noch Diskriminierung erfahren.
Dieses Jahr möchten wir die Gelegenheit nutzen, um auf konkrete Empowerment-Strategien hinzuweisen, die darauf abzielen, die Rechte, das Wohlbefinden und die Sichtbarkeit von LGBTQ+ Personen zu stärken. In unserem Lernangebot „Diversify!“ der HAW Hamburg gibt es viele wertvolle Informationen zum Thema Vielfalt – und auch Empowerment.

Empowerment kommt aus dem Englischen und steht für die Stärkung der politischen, sozialen, ökonomischen und spirituellen Kraft einer Person oder Community. Besonders wichtig ist dies bei Menschen, die von anhaltender und alltäglicher Diskriminierung betroffen sind – etwa durch Rassismus, Sexismus oder Klassismus. Empowerment marginalisierter Gruppen bedeutet, Kraft zu schöpfen und Selbstbestimmung zu fördern. Für eine diskriminierungssensible Gesellschaft braucht es jedoch auch Powersharing: die bewusste Abgabe von Einfluss durch diejenigen, die über mehr Macht verfügen.
Ein zentraler Bestandteil von Empowerment ist Bildung. Aufklärungsarbeit in Schulen, am Arbeitsplatz und in der Öffentlichkeit kann Vorurteile abbauen und das Verständnis für die Herausforderungen der LGBTQ+-Community stärken. Bildungsinitiativen schaffen eine Kultur der Akzeptanz und des Respekts – entscheidend für das Wohlbefinden aller.
Sichtbarkeit schafft Bewusstsein
Ebenso wichtig ist die Sichtbarkeit. Veranstaltungen und Kampagnen z.B im Pride Month bieten LGBTQ+-Personen Plattformen, um ihre Geschichten zu erzählen. Sichtbarkeit hilft, Stereotype aufzubrechen und ein breiteres Bewusstsein für die Vielfalt menschlicher Erfahrungen zu schaffen.
In unserem Lernangebot „Diversify!“ der HAW Hamburg findest du zahlreiche Handreichungen, wie du dich selbst und andere in deiner (Medien-)Arbeit empowern kannst – nicht nur im Kontext sexueller Vielfalt, sondern auch im Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus oder Ableismus.

Diversify
Die OER Diversify! sollte als ein Startpunkt verstanden werden, sich struktureller Diskriminierung, der Rolle der Medien und der Verantwortung der Lehre anzunähern.
Sensibilisierung, Empowerment und Positionierung
Im Lernangebot geht es auch um Fragen, die wir uns stellen können, um marginalisierte Personen zu unterstützen:
- Wie kann ich wenig sichtbare Personen in meiner Medienarbeit empowern?
- Welche Strategien helfen, den eigenen – oft begrenzten – Blickwinkel zu reflektieren?
- Können Medien barrierefreier und für alle zugänglich gestaltet werden?
- Wie lassen sich stereotype Vorstellungen in Sprache, Bild und Ton aufbrechen?
Gemeinsam Vielfalt gestalten
Lass uns diese Zeit als Erinnerung und Inspiration nutzen, jeden Tag aufs Neue für Gleichberechtigung, Akzeptanz und Empowerment einzutreten. Das Lernangebot „Diversify!“ unterstützt uns dabei. So können wir gemeinsam eine inklusive Zukunft gestalten, in der jeder Mensch die Freiheit hat, sich selbst voll und ganz zu entfalten.

Bild: ThisIsEngineering
14.03.2025 | Meena Stavesand
Gleichstellung in der Wissenschaft: Parität erst 2064?
Von Dorothea Christiane Erxlebens mutiger Promotion im 18. Jahrhundert bis zu den aktuellen Zahlen von nur 29 Prozent Professorinnen – unser Abschlussartikel zum Weltfrauentag blickt auf historische Vorbilder, aktuelle Herausforderungen und notwendige Veränderungen für eine echte Gleichstellung in Forschung und Lehre. Es geht um brillante Wissenschaftlerinnen, hartnäckige Widerstände und die Frage, warum wissenschaftlicher Fortschritt Vielfalt braucht – und wie lange wir noch auf Parität warten müssen.
Der Weltfrauentag am 8. März erinnert uns jedes Jahr daran, dass Gleichberechtigung kein Relikt vergangener Kämpfe ist, sondern eine lebendige Aufgabe bleibt. Seit Clara Zetkin 1911 den ersten internationalen Frauentag ins Leben rief, hat sich viel verändert – aber nicht genug. In der Wissenschaft spiegelt sich diese Entwicklung wie unter einem Brennglas wider: Beeindruckende Forschung steht neben großen Herausforderungen.
In unserer Serie zum Weltfrauentag haben wir eine Woche lang die Geschichten mutiger Wissenschaftlerinnen erzählt, ihre Durchbrüche und die Hürden, die sie überwinden mussten – und teilweise noch immer müssen – geschildert. Zum Abschluss dieser Reihe werfen wir einen umfassenden Blick auf dieses facettenreiche Thema.
Die Wegbereiterinnen: Mit Leidenschaft gegen Widerstände
Die Geschichte von Frauen in der Wissenschaft ist geprägt von außergewöhnlichem Mut. Dorothea Christiane Erxleben stellte sich Mitte des 18. Jahrhunderts gegen nahezu unüberwindbare gesellschaftliche Widerstände.
Sie praktizierte als Ärztin ohne formalen Abschluss und musste sich dafür sogar vor Gericht verantworten. Erst mit Unterstützung ihres Bruders und des preußischen Königs Friedrich des Großen konnte sie in Halle promovieren – ein Meilenstein, der bewies: Barrieren können fallen, wenn der Wille stark genug ist. Allerdings gilt das auch nicht immer, wie die Geschichte von Emmy Noether beweist – etwa 150 Jahre später:
Als erst zweite Frau in Deutschland promovierte Emmy Noether 1907 in Mathematik. Trotz eines formellen Verbots von 1908 versuchte sie, ihre Habilitation einzureichen. Der Mathematiker David Hilbert kämpfte für sie, doch offizielle Positionen blieben ihr verwehrt.
Der preußische Minister schrieb damals: „Die Zulassung von Frauen zur Habilitation als Privatdozent begegnet in akademischen Kreisen nach wie vor erheblichen Bedenken. Da die Frage nur grundsätzlich entschieden werden kann, vermag ich auch die Zulassung von Ausnahmen nicht zu genehmigen, selbst wenn im Einzelfall dadurch gewisse Härten unvermeidbar sind.“
Oft hielt Noether ihre Vorlesungen deswegen unter Hilberts Namen. Nach jahrelangem Ringen wurde ihr wegweisender Beitrag zur Abstrakten Algebra endlich anerkannt – heute gilt sie als Pionierin einer ganzen Epoche.
Dass Frauen in der Wissenschaft oft im Schatten standen, zeigt auch Rosalind Franklins Geschichte: Sie bewies als Biochemikerin und Spezialistin für Röntgenstrukturanalyse mit dem Foto 51 die Doppelhelix unser DNA. Den Nobelpreis bekamen allerdings zwei Männer: James Watson und Francis Crick, obwohl deren Forschung auf Rosalind Franklins Arbeiten beruhte. Ihr Anspruch erlosch mit ihrem frühen Tod 1958, da der Nobelpreis nicht posthum verliehen wird. Sie starb an Krebs – möglicherweise eine Auswirkung ihrer Arbeit mit Röntgenstrahlen.
Diese drei Biografien zeigen, wie hart der Kampf um wissenschaftliche Anerkennung in den vergangenen Jahrhunderten und Jahrzehnten war. Sie beweisen auch, dass bedeutende Fortschritte oft dann entstehen, wenn Frauen gegen strukturelle Widerstände angehen und gleichzeitig neue Denkweisen etablieren.
Gegenwart: Zwischen Fortschritt und Stillstand
Die heutige Situation zeigt ein gemischtes Bild. Es gibt messbare Fortschritte, aber auch Unterschiede:
- Der Frauenanteil in wissenschaftlichen Führungspositionen stieg von 13,5 Prozent (2013) auf 24,2 Prozent (2023).
- Über die Hälfte (52,3 Prozent) der Studienanfänger:innen waren 2022 weiblich – ein ausgeglichenes Verhältnis auf der Einstiegsstufe.
- Nur 29 Prozent der Professuren in Deutschland sind mit Frauen besetzt (2023).
Klassische Rollenbilder beeinflussen nach wie vor viele Karriereverläufe. Frauen übernehmen überdurchschnittlich viel unbezahlte Care-Arbeit, was ihre Zeit für Forschung und Publikationen einschränkt.

Es braucht Chancengleichheit – sowohl strukturell als auch in den Köpfen der Menschen.Katrin Bock, TU Hamburg
Der sogenannte Gender Publication Gap belegt: Wissenschaftlerinnen veröffentlichen tendenziell weniger Artikel als ihre männlichen Kollegen. Jede zweite Forscherin berichtet zudem von Fällen, in denen ihr Beitrag schlichtweg übersehen wurde.
„Es braucht Chancengleichheit – sowohl strukturell als auch in den Köpfen der Menschen!“ Dieses Zitat von Katrin Bock, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Hamburg, bringt es auf den Punkt. Gleichzeitig ist vor allem eins wichtig, wie Dr. Sophie Heins, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HafenCity Universität verdeutlicht: „Im Design und der Designforschung ist Vernetzung entscheidend, um Frauen sichtbarer zu machen“, antwortet sie auf die Frage, was es braucht, damit Frauen in dem eigenen Fachbereich noch stärker wirken können und sichtbarer werden.
Der Weg zur echten Gleichstellung: Parität erst 2064?
Der Glass Ceiling Index belegt weiterhin eine gläserne Decke zwischen Promotion und Professur. Obwohl der Frauenanteil bei Promotionen deutlich gestiegen ist, bleibt er bei den höchsten Professuren weit zurück:
„Wenn der Frauenanteil an den höchsten Professuren in gleicher Weise wie seit 1992 wachsen würde, wäre eine Parität im Jahr 2064 erreicht (…). Auch wenn das etwas schnellere Wachstum der letzten 10 Jahre zugrunde gelegt würde, wäre eine Parität erst 2057 erreicht“, heißt es in der Bilanz „30 Jahre Geschlechtergleichstellung in der Wissenschaft“.
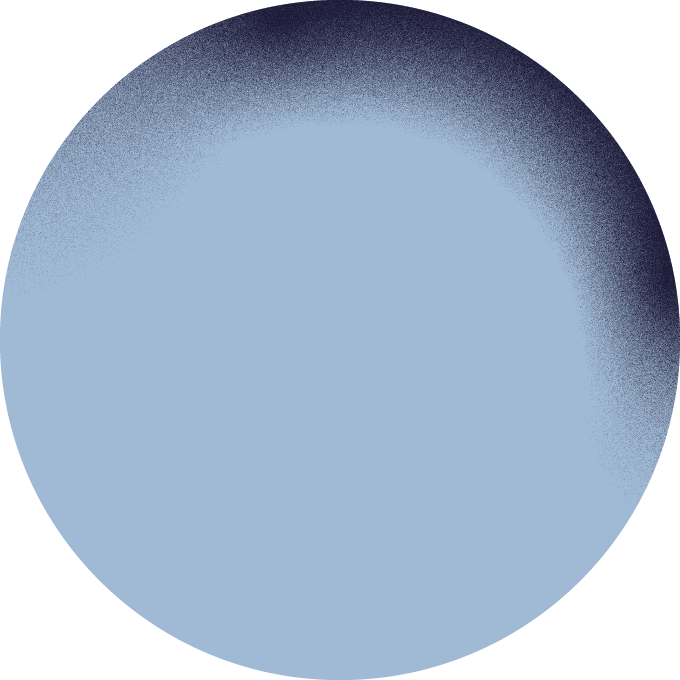
29
Prozent der Professuren sind in Deutschland mit Frauen besetzt.
Die Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie bleibt ein zentrales Thema – auch unter Wissenschaftlerinnen: „In der Wissenschaft braucht es mehr Frauen in Führungspositionen, um Veränderung zu bewirken und junge Wissenschaftlerinnen zu inspirieren“, sagt Dr. Franziska Miegel, psychologische Psychotherapeutin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Von mehr Flexibilität und der Anerkennung von Care-Arbeit würden jedoch alle Forschenden profitieren. Wenn dieses Umdenken gelingt, müsste niemand mehr zwischen Familie und Karriere wählen.
Ausblick: Was die Zukunft bringen muss
Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz hat die Förderung von Frauen in Wissenschaft und Forschung als wichtiges Querschnittsthema definiert. Damit sind die Grundlagen für Veränderung geschaffen. Was jetzt folgen muss, sind konkrete Maßnahmen wie etwa:
- Strukturelle Reformen zur Förderung von Frauen auf allen Karrierestufen
- Ein kultureller Wandel, um starre Denkmuster aufzubrechen
- Ausgebaute Mentoring- und Vernetzungsangebote
- Mehr Sensibilität für Care-Arbeit und faire Arbeitsbedingungen
Die Zahlen belegen, dass wir Fortschritte machen – aber das Tempo könnte schneller sein. Dass eine positive Entwicklung stattfindet, ist sicherlich auch dem unbeugsamen Engagement jener Frauen zu verdanken, die sich nicht abschrecken ließen: von Dorothea Christiane Erxleben über Rosalind Franklin bis hin zu Emmy Noether. Sie haben bewiesen, dass herausragender Forschungsgeist weder einem Geschlecht noch bestimmten Rollenmustern untergeordnet ist.

Lange hielt die Welt an dem Irrglauben fest, Frauen fehle es an Kreativität und Fähigkeiten. Diese Vorstellung ist falsch, und sie zu widerlegen motiviert uns, sichtbarer und einflussreicher zu werden.Tam Thi Pham, Hochschule für Musik und Theater
Mehr Mut, mehr Gleichberechtigung, mehr Sichtbarkeit
Der Weltfrauentag mahnt uns jedes Jahr aufs Neue, nicht nachzulassen. Er erinnert aber auch daran, wie viel Frauen schon erreicht haben – gerade in der Wissenschaft. Tam Thi Pham, Komponistin, Improvisateurin und Projektkoordinatorin an der Hochschule für Musik und Theater fasst daher treffend zusammen: „Lange hielt die Welt an dem Irrglauben fest, Frauen fehle es an Kreativität und Fähigkeiten. Diese Vorstellung ist falsch, und sie zu widerlegen motiviert uns, sichtbarer und einflussreicher zu werden.“

Foto: Gerd Altmann / Pixabay
12.02.2025 | Meena Stavesand
"Wissenschaft lebt von Perspektivenvielfalt und Interdisziplinarität"
Prof. Dr. Maren Baumhauer ist seit Februar neues Mitglied im HOOU-Aufsichtsrat. Anlässlich des internationalen Tags der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft gibt sie Einblicke in die Zukunft des Wissenschaftssystems. Sie betont, dass echter Fortschritt nur durch fachübergreifende Zusammenarbeit und multiprofessionelle Teams entstehen kann.
Prof. Baumhauer setzt sich für transparente Bildungsangebote ein und macht mit innovativen Projekten wie dem „Navigator für KI-Einsteiger“ Wissenschaft für alle zugänglich. Dabei unterstreicht sie die Bedeutung einer offenen Wissenschaftskultur, die nicht nur den technologischen Fortschritt vorantreibt, sondern auch das gesellschaftliche Vertrauen in die Forschung stärkt.
Was macht Wissenschaft für unsere Gesellschaft so wertvoll und wie bereichert uns die Vielfalt der Perspektiven in der Forschung?
Prof. Dr. Maren Baumhauer: Meines Erachtens liegt gerade die Zukunft unseres Wissenschaftssystems in der Interdisziplinarität und einer Perspektivenverschränkung unterschiedlichster Forschungsansätze und -strategien begründet. Sicherlich ist der Aspekt der Selbstbehauptung und Anerkennung, gerade wenn es um das „eigene“ Gegenstandsinteresse einer Disziplin geht wichtig.
Ein „echter“ Fortschritt – im Sinne eines konkreten Mehrwerts für die Gesellschaft – lässt sich aus meiner Sicht aber nur mit einem „Blick über den eigenen Tellerrand“ und über die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams erzeugen. Wenn ich den Wert von Wissenschaft an bestimmten Kategorien festmachen müsste, würde ich vor allem den Erkenntnisgewinn, den technologischen Fortschritt und die Innovation, ihren kulturellen Beitrag und die Weiterentwicklung der Gesellschaft sowie die offenen Bildungsmöglichkeiten für Individuen herausstellen.

Der Internationale Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft (englisch: International Day of Women and Girls in Science) wird jedes Jahr am 11. Februar begangen und wurde erstmals 2016 offiziell gefeiert. Ausgerufen von den Vereinten Nationen, soll dieser Tag auf die nach wie vor bestehenden Ungleichheiten in wissenschaftlichen Disziplinen aufmerksam machen. Ziel ist es, die volle und gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Mädchen in den Bereichen Wissenschaft, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik zu fördern. Gleichzeitig erinnert der Tag daran, dass Diversität und Chancengleichheit entscheidend sind, um Innovationen voranzutreiben und globale Herausforderungen zu meistern.
Wie können wir die Wissenschaftswelt offener und zukunftsfähiger gestalten?
Prof. Dr. Maren Baumhauer: Ein „offenes“ Konzept von Wissenschaft und Bildung hat aus meiner Sicht eine hohe Bedeutung für die Zusammenarbeit in Bildungsorganisationen und den Austausch von Wissen. Gemeinsam Wissensstrukturen zu erzeugen, zu teilen und voneinander zu profitieren ist für die kollektive und individuelle Kompetenzentwicklung im Kontext von Arbeit, Beruf und Bildung enorm wichtig.
Ein weiterer zentraler Punkt ist aus meiner Perspektive das gesellschaftliche Vertrauen in die Wissenschaft zu stärken. Transparente Bildungsangebote und der freie Zugang zu wissenschaftlich basierten Bildungsmaterialien können dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Genau diese Punkte sehe ich in den Bildungsinitiativen und offenen Lernangeboten der HOOU realisiert.
Ein aktuelles Beispiel ist der „Navigator für KI-Einsteiger“, den ich zusammen mit meinem Team konzipiert habe. Künstliche Intelligenz (KI) ist längst Teil unserer Bildungsrealität geworden. Unser Lernangebot richtet sich an alle Bildungsinteressierten und bietet neue Impulse, sich Schritt für Schritt dem Thema KI anzunähern, um ihre Möglichkeiten und Grenzen zu reflektieren.

Schritt für Schritt: Ein Navigator für KI-Einsteiger
Künstliche Intelligenz (KI) hat sich inzwischen zu einem integralen Bestandteil unseres Alltags entwickelt. Mit innovativen KI-Tools wie ChatGPT, DALL-E oder Gemini ist es möglich, Texte zu erstellen, Bilder zu generieren, Musik zu komponieren und komplexe Probleme zu lösen.KI bietet zahlreiche Chancen, bringt jedoch auch Herausforderungen und Risiken mit sich. Daher ist es von Bedeutung, sich aktiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen, um die Möglichkeiten und Grenzen dieser technischen Entwicklung zu verstehen.Unser Lernangebot zeigt dir einen Weg auf, wie du dich Schritt für Schritt mit dem Thema KI vertraut machen kannst.
Was hat in Ihnen die Begeisterung für die Wissenschaft geweckt und welchen Rat möchten Sie jungen Menschen geben, die eine wissenschaftliche Laufbahn erwägen?
Prof. Dr. Maren Baumhauer: Wissenschaftlich zu arbeiten bedeutet für mich absolute Freiheit und kreative Entfaltungsmöglichkeit im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit. Das ist eine großartige Chance, die das Wissenschaftssystem für junge Menschen bietet. Herausfordernder war und ist es, geeignete Rahmenbedingungen im Kontext andauernder Befristung zu schaffen, um weder Energie noch Muße für die wissenschaftlichen Qualifizierungsphasen zu verlieren.
Für die Bewältigung dieser Phasen bedarf es eines zielgerichteten Ressourceneinsatzes, um sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Absolut wichtig ist für mich darüber hinaus die Entwicklung von Ambiguitätskompetenz im Wissenschaftssystem, die sich auf den Umgang mit Unsicherheiten und auch Mehrdeutigkeiten bezieht. Eine offene Haltung im Umgang mit Widersprüchen, unterschiedlichen Perspektiven und Erklärungsansätzen ist dafür unerlässlich.
Über Prof. Dr. Maren Baumhauer

Prof. Dr. Maren Baumhauer ist Juniorprofessorin für Berufliche Bildung und Digitalisierung am Dekanat T (Technologie und Innovation in der Bildung) an der TU Hamburg. Nach dem Studium der Erziehungswissenschaften (Dipl.-Päd.) an der Universität Trier mit den Nebenfächern Soziologie und Psychologie, Studienrichtung Weiterbildung, folgten Stationen als Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universittät Trier und der Leibniz Universität Hannover.
Ihre Promotion legte Baumhauer in Berufspädagogik ab. Titel ihrer Dissertation: Berufsbezug und Wissenschaftsorientierung – Grundzüge einer Didaktik wissenschaftlich reflektierter (Berufs-)Praxis im Kontext der Hochschulweiterbildung. Seit 2023 forscht und lehrt sie an der TU Hamburg.

Bild: StockSnap / Pixabay
29.01.2025 | Meena Stavesand
Interkulturelle Kommunikation: Was einen Menschen prägt, beeinflusst seine Handlungen
Eine ausgestreckte Hand zum Gruß, aber das Gegenüber winkt nur kurz. Verwirrung auf beiden Seiten. Was passiert hier? Wie gehe ich mit der Situation um? Mit solchen Fragen befasst sich die interkulturelle Kommunikation. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff? Und wie lässt sich der Umgang mit kulturellen Unterschieden lernen?
An der HAW Hamburg hat ein interdisziplinäres Team aus Expertinnen und Experten drei digitale Lerneinheiten entwickelt, sogenannte Eduboxes. Sie enthalten Lehr- und Lernmaterialien zu Themen der Interkulturellen Kommunikation, die digital verfügbar und flexibel einsetzbar sind. Diese Materialien sollen dabei unterstützen, Kompetenzen zu entwickeln um die Herausforderungen einer vernetzten und sich schnell verändernden Welt gut zu bewältigen und als Chance wahrnehmen zu können.
Im Interview erklärt Prof. Dr. Adelheid Iken, warum es bei der Interkulturellen Kommunikation nicht um pauschale Zuschreibungen wie „der Spanier“ oder „die Chinesin“ geht, sondern um individuelles, gegenseitiges Verständnis und dem Aushandeln gemeinsamer Handlungsroutinen. Und sie erläutert, wie interkulturelle Kompetenz dazu beitragen kann, die Herausforderungen von virtuellen internationalen Teams zu bewältigen.
Was ist interkulturelle Kommunikation?
Prof. Dr. Adelheid Iken: Das Wort Kommunikation kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Mitteilung, Austausch und Übertragung. Das „Inter“ steht für „zwischen“ – zwischen Menschen, zwischen Personen. Es geht also um Interaktionen in ganz unterschiedlichen Lebens-, Alltags- und Berufskontexten.
Die Kultur kommt als dritter Aspekt hinzu: Jeder wird durch die Zugehörigkeit zu ganz unterschiedlichen Gruppen und Lebenswelten geprägt. Da geht es beispielsweise um die die Familie, das Umfeld, in dem eine Person aufwächst, den Beruf und den Sportclub in dem jemand Mitglied ist. , Die Interkulturelle Kommunikation bezieht sich auf die Prozesse, die zwischen Personen stattfinden, die über unterschiedliche Gruppenzugehörigkeiten verfügen.
Uns geht es daher nicht um „den Griechen“ oder „den Spanier“, der sich in einer bestimmten Weise verhält – das wäre zu pauschalisierend und verallgemeinernd. In der Interaktion beschäftigen wir uns mit dem Individuum, mit der Person, die uns gegenübersitzt.

Oft gehen wir davon aus, dass unsere Art sich zu verhalten die richtige ist. In der Zusammenarbeit mit anderen merken wir dann: Es gibt verschiedene Wege zum Ziel. Für den gemeinsamen Erfolg ist dann die Verständigung und das Aushandeln von wichtig.Prof. Dr. Adelheid Iken
Können Sie das anhand eines Beispiels aus dem Alltag erklären?
Prof. Dr. Adelheid Iken: An der Hochschule treffen sich zwei Menschen zum ersten Mal. Eine Person streckt die Hand zum Handschlag aus, die andere winkt nur kurz. Das sind zwei unterschiedliche Begrüßungsrituale, und das kann verwirren – besonders wenn man seit 20 Jahren an der Hochschule ist und eine bestimmte Form der Begrüßung gewohnt ist.
Eine solche Situation lässt sich schnell erklären und häufig auch klären. Hier fehlt offensichtlich das Verständnis darüber, was an der Hochschule als ‚normal‘ wahrgenommen wird und es gilt, eine gemeinsame Handlungsroutine zu entwickeln.
Komplexer wird es bei der Zusammenarbeit in interkulturellen Teams oder der Arbeit an gemeinsamen Projekten. Hier kann es Verwirrungen oder Irritationen geben, weil Teammitglieder ein unterschiedliches Verständnis von Zusammenarbeit haben, in der Art und Weise Kritik zu üben oder zu kommunizieren. Dann gilt es, innezuhalten, zu reflektieren, zu analysieren, Fragen zu stellen und offen für die Sichtweise des anderen zu sein.

Interkulturelle Kommunikation
...unterstützt Sie bei der Entwicklung von interkulturellen Kompetenzen, die in einer Reihe von beruflichen, sozialen und Arbeitszusammenhängen benötigt werden.
Wie kann ich lernen, mit solchen Situationen umzugehen?
Prof. Dr. Adelheid Iken: Es beginnt beispielsweise mit aktivem Zuhören und einem Perspektivwechsel. Man versetzt sich in die Situation des anderen und stellt Fragen. Das lässt sich lernen und wird ein Teil der eigenen Kompetenzen. Oft gehen wir davon aus, dass unsere Art sich zu verhalten die richtige ist. In der Zusammenarbeit mit anderen merken wir dann: Es gibt verschiedene Wege zum Ziel. Für den gemeinsamen Erfolg ist dann die Verständigung und das Aushandeln von wichtig.
Um ein einfaches Beispiel zu nennen. Ein Mitglied im Team gibt seinen oder ihren Arbeitsbeitrag immer erst in letzter Minute ab, was mich aber nervös macht, weil ich gerne frühzeitig alle Unterlagen zusammen haben möchte.
Anstatt direkte Kritik zu üben, hilft es Fragen zu stellen und gegenseitige Erwartungen zu klären. Das hilft meistens schon, eine gemeinsame Lösung zu finden. In diesem Fall könnte es sein, dass beide ein unterschiedliches Verständnis von Deadlines und den Arbeitsprozessen haben um eine mögliche Erklärung zu nennen.
Um diese Fähigkeit zu schulen, gibt es ein Lernangebot, das sich mit der interkulturellen Kommunikation beschäftigt. Sie haben dafür etwas Besonderes konzipiert: die Edubox. Was ist das?
Prof. Dr. Adelheid Iken: Edubox steht für Educational Boxes – virtuelle Boxen in denen Lehr- und Lernmaterialien zu finden sind die ganz unterschiedlich eingesetzt werden können und damit sowohl für Lernende als auch für Lehrende und Trainer genutzt werden können.
Die Box „Interkulturelle Kommunikation“ beispielsweise hat neun Lerneinheiten und es gibt sie auf Deutsch und auf Englisch. Sie enthält Texte, Fallbeispiele, Videos und Reflexionsfragen. Und es gibt die Möglichkeit, Learning Journals zu führen – eine Art Lerntagebuch, um das Erlernte zu dokumentieren.
Das Material der EduBox eignet sich für ein Selbststudium aber auch für den Unterricht als Flipped Classroom: Das Material wird vorab er- und bearbeitet. Im Unterricht folgen dann praktische Übungen.

Stell dir einen digitalen Werkzeugkasten fürs interkulturelle Lernen vor – das ist eine Edubox. Nach einer kurzen Einführung, die den Aufbau erklärt, geht es direkt los: Du findest eine übersichtliche Navigation durch alle Lerneinheiten. Jede Einheit verrät dir zu Beginn, was du dort lernen kannst. Dann folgt ein Mix aus Theorie, praktischen Beispielen, Übungen und Fragen zum Nachdenken. Das Besondere: Du entscheidest selbst, was dich interessiert. Kennst du ein Thema schon? Dann spring einfach zum nächsten. Am Ende jeder Einheit kannst du mit einer Übung testen, was hängen geblieben ist.
Welche weiteren Boxen gibt es?
Prof. Dr. Adelheid Iken: Neben der EduBox zur interkulturellen Kommunikation gibt es eine EduBox, bei der das Thema der Zusammenarbeit in virtuellen interkulturellen Teams im Zentrum steht. Dabei geht es um die besonderen Herausforderungen virtueller Zusammenarbeit und wie ich es schaffe, aus einer heterogenen Gruppe von Personen ein hoch effizientes virtuelles Team zu entwickeln.
Bei Design Thinking handelt es sich um ein agiles Werkzeug und ein Ansatz zur Bewältigung komplexer Herausforderungen. Es hilft Teams, reale Herausforderungen anzugehen und schnell von Ideen zu potenziellen Lösungen zu gelangen. Wie man Design Thinking nutzen kann, ist Inhalt der dritten EduBox.
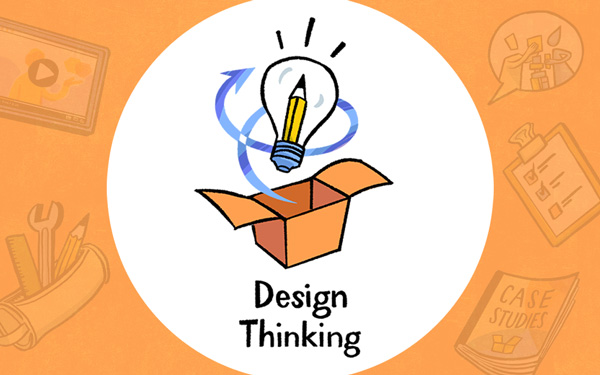
Design Thinking
Are you looking for creative solutions to a challenge you’re facing? If so, the EduBox “Design Thinking” is for you! It helps you practice virtual collaboration in diverse teams using a step-by-step approach to Design Thinking.
Wie groß ist das Team, das diese Boxen entwickelt?
Prof. Dr. Adelheid Iken: Die Schreib-Teams umfassen meist fünf bis sechs Personen, beim Design Thinking waren es weniger. Unser interdisziplinäres Team besteht aus Expert:innen der Interkulturellen Kommunikation und des interkulturellen Managements, aber auch der Erwachsenenbildung und der Wirtschaftsinformatik, es sind Lehrende aus Hochschulen dabei, ebenso wie freie Trainer:innen und natürlich IT-Fachkräfte und Illustrator:innen.

Virtual Intercultural Teams
This course will help you identify and tackle the key challenges of working in virtual intercultural teams, while building the professional and social competencies needed to achieve higher performance as well as job satisfaction when working in virtual intercultural environments.
Wird es noch eine vierte Box geben oder was ist geplant?
Prof. Dr. Adelheid Iken: Eine vierte EduBox ist zurzeit nicht geplant, aber wir verstehen unsere Arbeit als fortlaufenden Prozess. Das digitale Format ermöglicht es uns, Feedback einzuarbeiten und die Inhalte weiterzuentwickeln. Zwischen der ersten und zweiten Version der Box Interkulturelle Kommunikation haben wir beispielsweise unser Kommunikationsmodell überarbeitet. Und wir haben für alle drei Boxen ein Trainerhandbuch entwickelt.
Im Augenblick ist es uns wichtig, unsere Boxen bekannter zu machen. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, alle EduBoxen in englischer Sprache zur Verfügung zu stellen, weil wir Interessierte weltweit ansprechen wollen und den globalen Austausch ermöglichen möchten Daran arbeiten wir.
Über Prof. Dr. Adelheid Iken
Studium an der Universität Hamburg und an der London School of Oriental and African Studies (Ethnologie, Soziologie, Politische Wissenschaften und Amharisch). Anschließend Ausbildung zur Landwirtin.
10-jährige Berufs- und Forschungstätigkeit insbesondere in Ländern Afrikas (u.a. Äthiopien, Sudan, Namibia) und in der Mongolei.
Dissertation über frauenzentrierte Haushalte in Südnamibia (Women-headed Households in Southern Namibia: Causes, Patterns and Consequences).
Von 2002 bis 2023 Professorin für Interkulturelle Kommunikation an der HAW Hamburg

Zum Reinhören
Wenn du gerne Podcasts hörst, haben wir zu dem Thema noch drei Episoden für dich – zu interkultureller Kommunikation, zu interkulturellen virtuellen Teams und zu Design Thinking.

On the benefits of using Design Thinking
In this episode Christian Friedrich will be talking to Erik Schumb, an expert agile coach with years of experience in Design Thinking, about the benefits of using Design Thinking.
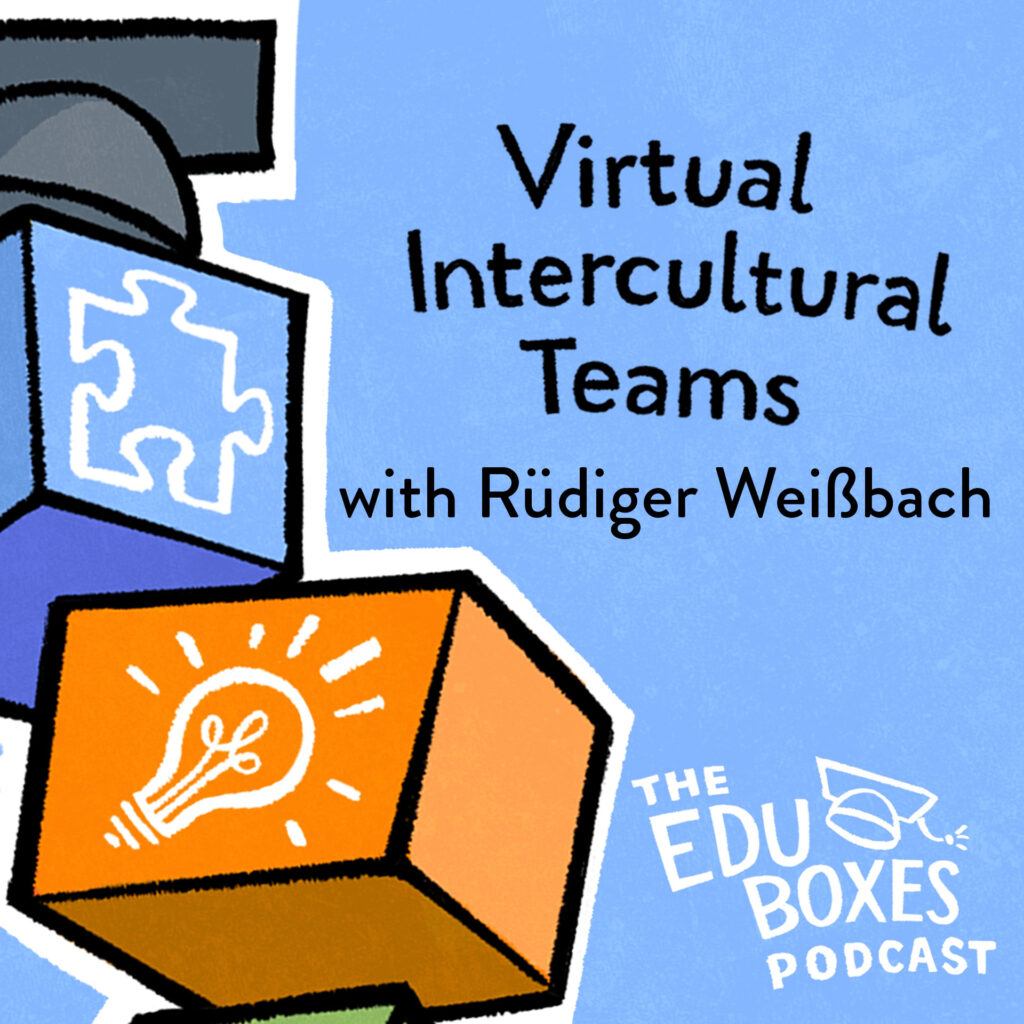
Intercultural Communication with Rüdiger Weißbach
In this episode Christian Friedrich will be talking to Rüdiger Weißbach, Professor at the Hamburg University of Applied Sciences, about Meeting the challenges of virtual intercultural teams.

Intercultural Communication with Anna Volquardsen
In this episode Christian Friedrich will be talking to Anna Volquardsen, founder of DEARWORK on the current relevance of Intercultural Communication.

Bild: Raphael Renter/Unsplash
25.06.2024 | Meena Stavesand
Empowerment im Pride Month: So unterstützt du die LGBTQ+-Community
Jeden Juni hissen Menschen, Unternehmen, Organisationen und Initiativen die Regenbogenfahne und feiern den Pride Month. Es ist eine Zeit, die sowohl dem Gedenken als auch der Anerkennung der LGBTQ+-Community gewidmet ist. Wir erklären dir, wie der Pride Month entstanden ist, warum es ihn gibt und was du selbst tun kannst, um marginalisierte Gruppen zu unterstützen. Es geht um Vielfalt und Empowerment.
Der Pride Month, der jedes Jahr im Juni stattfindet, erinnert an die Stonewall-Unruhen 1969 in New York. Es war ein Wendepunkt in der Bürgerrechtsbewegung der LGBTQ+-Gemeinschaft. Die historischen Ereignisse markierten den Beginn einer neuen Ära des Widerstands und der Forderung nach Gleichberechtigung, die bis heute anhält.
So entstand die Gay Pride
In den 1960er Jahren war in den USA ein gesellschaftlicher Aufbruch spürbar, von dem Homosexuelle jedoch zunächst kaum profitierten. Auf der Grundlage der so genannten „Sodomie-Gesetze“ wurden sie in vielen Bundesstaaten strafrechtlich verfolgt und in verschiedenen Lebensbereichen – etwa auf dem Wohnungsmarkt oder am Arbeitsplatz – diskriminiert.
Der Widerstand gegen diese Diskriminierung begann symbolisch mit den Stonewall-Unruhen in der New Yorker Christopher Street vor 55 Jahren, ein Ereignis, das die LGBTQ+-Bewegung bis heute prägt.
Razzia als Auslöser der Stonewall-Unruhen
In den 1960er Jahren konnten sich Homosexuelle in New York nur an bestimmten Orten treffen. Bars, die als solche Treffpunkte bekannt waren, erhielten von den Behörden keine Alkohollizenz. Dies machte sich die Mafia zunutze und betrieb diese Orte als „Privatclubs“ ohne Lizenz.

It was a rebellion, it was an uprising, it was a civil rights disobedience—it wasn’t no damn riot.
Stormé DeLarverie über die Stonewall-Unruhen
So kam es dort regelmäßig zu Razzien der Polizei, die oft mit Übergriffen endeten oder auch die Identitäten der Homosexuellen öffentlich machten. Die Razzia in der Bar „Stonewall Inn“ am 28. Juni 1969 eskalierte schließlich, als sich die Gäste gegen die Polizeikontrollen wehrten, vermutlich ermutigt durch den Widerstand der lesbischen Sängerin Stormé DeLarverie. Die darauf folgende Solidarisierung innerhalb der homosexuellen Community und der Nachbarschaft führte zu tagelangen Auseinandersetzungen mit der Polizei in der Christopher Street.
Grundstein für weltweite Bewegung
Schon vor Stonewall hatten sich Homosexuelle in den USA organisiert, doch die Ereignisse von 1969 markierten einen entscheidenden Wendepunkt für die amerikanische Schwulen- und Lesbenbewegung. Es folgte der erste „Christopher Street Liberation Day“ mit einer Parade am 28. Juni 1970, an der rund 4000 Menschen teilnahmen.
Daraus entwickelte sich schnell eine weltweite Bewegung, die unter dem Namen „Gay Pride“ die Forderung nach gleichen Rechten für Homosexuelle auf der ganzen Welt unterstützte.
In Deutschland kämpfte die Schwulen- und Lesbenbewegung in den 1960er Jahren vor allem gegen das Sexualstrafrecht, das Homosexualität unter Strafe stellte. Der erste „Christopher Street Day“ in Deutschland fand dann am 28. Juni 1979 in Berlin statt, genau zehn Jahre nach den Stonewall-Unruhen. Er wurde zum Symbol des Widerstands und der Forderung nach Gleichberechtigung in Deutschland.
Noch immer Opfer von Diskriminierung und Gewalt
Obwohl sich der Christopher Street Day als Bewegung weltweit etabliert hat und wir im Juni den Pride Month feiern, sind Homosexuelle auch heute noch Opfer von Diskriminierung und Gewalt. So wurden im Juni 2016 bei einem der schlimmsten Anschläge in der Geschichte der USA in einem LGBT-Club in Orlando/Florida 49 Menschen getötet.
Deshalb ist es wichtig und notwendig, nicht nur die Erfolge der Bewegung zu feiern, sondern auch auf die anhaltenden Kämpfe für Gleichberechtigung und Akzeptanz aufmerksam zu machen. Es geht um mehr als das Hissen einer Regenbogenfahne.
Denn heute steht der Pride Month für das kontinuierliche Streben nach einer inklusiven Gesellschaft, in der jeder Mensch unabhängig von seiner sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität die gleichen Rechte und Chancen genießt. Es geht darum, die Stimmen derer zu stärken, die oft am Rande der Gesellschaft stehen, und Strategien zu fördern, die nachhaltige Veränderungen bewirken können.
Empowerment: Wohlbefinden und Sichtbarkeit verbessern
Dieses Jahr möchten wir die Gelegenheit nutzen, um auf spezifische Empowerment-Strategien hinzuweisen, die darauf abzielen, die Rechte, das Wohlbefinden und die Sichtbarkeit von LGBTQ+-Personen zu stärken. In unserem Lernangebot „Diversify!“ der HAW Hamburg findest du viele interessante Informationen zum Thema Diversity – und auch zum Thema Empowerment.

Der Begriff Empowerment kommt aus dem Englischen. Empowerment bedeutet, die politische, soziale, wirtschaftliche und spirituelle Kraft einer Person oder Gemeinschaft zu stärken. Dies ist besonders wichtig für Menschen, die von anhaltender und alltäglicher Diskriminierung betroffen sind, zum Beispiel durch Rassismus, Sexismus oder Klassismus. Empowerment von marginalisierten Personen und Gemeinschaften (die wenig Macht haben) ist wichtig, um Kraft zu schöpfen. Für eine diskriminierungssensible Gesellschaft braucht es gleichzeitig Machtteilung durch diejenigen, die viel Macht haben.
Ein zentraler Aspekt von Empowerment während des Pride Month ist Bildung. Aufklärungsarbeit in Schulen, am Arbeitsplatz und in der Gemeinschaft kann dazu beitragen, Mythen zu entkräften und ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen der LGBTQ+-Gemeinschaft zu schaffen. Bildungsinitiativen tragen dazu bei, eine Kultur der Akzeptanz und des Respekts zu fördern, die für das Wohlergehen aller Mitglieder der Gesellschaft unerlässlich ist.
Sichtbarkeit schafft Bewusstsein
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Erhöhung der Sichtbarkeit. Die Veranstaltungen und Kampagnen des Pride Month bieten eine Plattform, auf der LGBTQ+-Personen ihre Geschichten teilen und feiern können. Diese Sichtbarkeit ist entscheidend, um Stereotypen zu durchbrechen und ein breiteres Bewusstsein für die Vielfalt menschlicher Erfahrungen zu schaffen.
In unserem Lernangebot „Diversify!“ findest du viele Werkzeuge, um dich selbst und andere zu empowern. Dabei geht es nicht nur um sexuelle Vielfalt, sondern auch um den Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus oder Ableismus.
Sensibilisierung, Empowerment und Positionierung
In dem Lernangebot stellen wir uns selbst bestimmte Fragen, um andere Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, zu unterstützen.
- Wie kann ich wenig sichtbare Menschen durch meine Medienarbeit empowern?
- Welche Strategien gibt es, den eigenen, manchmal eingeschränkten Blickwinkel zu reflektieren?
- Können Medien für alle zugänglich gemacht werden?
- Wie manifestieren sich Stereotype in Sprache, Bild und Ton? Wie können wir sie verändern?
Diversify!
Lasse uns diesen und alle weiteren Pride Months als Mahnung und Inspiration nutzen, jeden Tag aufs Neue für Gleichberechtigung, Akzeptanz und Empowerment zu kämpfen. Unser Angebot „Diversify!“ der HAW Hamburg hilft uns dabei. So können wir gemeinsam eine inklusive Zukunft gestalten, in der jeder Mensch die Freiheit hat, sich voll zu entfalten.

Bild: Claudio Schwarz/Unsplash
02.04.2024 | Meena Stavesand
Vielfalt: So gelingt Diversität in den Medien
Es ist Pride Week und gerade derzeit bedienen sich Medien oft stereotyper Darstellungen. Die HAW hat in ihrem neuen Angebot alle Fragen zu einer diversitätssenbilen Mediengestaltung beantwortet. Es geht etwa um Empowerment, Gendern und Barrierefreiheit.
Wir beantworten euch einige wichtige Fragen zu einer diversitätsseniblen Mediengestaltung. Wenn ihr euch damit intensiver beschäftigen möchtet, dann klickt unbedingt unser kostenloses Lernangebot der HAW an.
Alles Wissenswerte über einseitige Blickwinkel, Diskriminierung und Intersektionalität
Die Expert:innen erklären Strategien, um den eigenen, manchmal begrenzten Blickwinkel zu reflektieren, um Diskriminierungsformen wie stereotype Darstellungen in Sprache, Bild und Ton und um Intersektionalität, wo sich etwa mit der Frage beschäftigt wird, warum selten über Morde an Schwarzen Frauen berichtet wird.
Wie kann ich rassismuskritisch fotografieren?
Menschen, die Rassismus erleiden, begegnen in ihrem Leben häufig intensiven Blicken und stehen unter ständiger Beobachtung. Solche Handlungen markieren diese Menschen als auffällig, „anders“ oder „fremd“. Weiße Menschen können hingegen oft unbemerkt bleiben, während sie andere beobachten. Dieser Akt des Beobachtens reflektiert die Vorrechte weißer Menschen, die ebenfalls tief in der Historie der weißen Fotografie und des Reisefilms verwurzelt sind. Diese Medien wurden als Werkzeuge eingesetzt, um Rassismus zu legitimieren und „zu bestätigen“. Fotografie und später der Reisefilm stellten die Hauptmedien dar, um rassistische Erzählungen zu verstärken und zu verbreiten. Die Folgen dieser rassistischen Betrachtungsweisen, Perspektiven und Bildkonstruktionen sind bis heute sehr deutlich in der Darstellung von People of Color und schwarzen Menschen erkennbar. Lies hier, was du dagegen tun kannst.
Sternchen oder Doppelpunkt? Wie gendere ich barrierearm?
Das Thema der geschlechtergerechten Ausdrucksweise ist ein Punkt heftiger Diskussionen. Während einige die Verwendung männlicher Formulierungen kritisieren, weil sie die Vielfalt der Geschlechter verdecken, behaupten andere, dass Texte durch geschlechtergerechte Sprache unleserlich und unverständlich werden. Ein Aspekt, der in der hitzigen Diskussion über geschlechtergerechte Sprache oft verloren geht, sind die Beweggründe für eine geschlechtergerechte Kommunikation. Diese liegen in der Darstellung der Geschlechtervielfalt, dem Wunsch nach Zugehörigkeitsgefühl, etwa in einem bisher männlich dominierten Berufsfeld, einem Club, einem Parlament und so weiter oder in der Thematisierung von Geschlechterdisparitäten. Was es damit auf sich hat, liest du hier.
Wie gestalte ich einen Text oder eine Webseite barrierearm?
Ableistische Sprache bezieht sich auf eine Ausdrucksweise, die Menschen nach bestimmten Fähigkeiten bewertet und sie daher in Kategorien wie „normal“ und „nicht-normal“ einordnet. Bezeichnungen wie „Pflegefall“, „Liliputaner:in“ und „Taubstumme:r“ reduzieren Menschen auf ihre Einschränkungen und sind oft inhaltlich ungenau. Hierbei wird die Beeinträchtigung, unter der die betroffene Person vermeintlich „leidet“, in den Mittelpunkt der Darstellung gestellt. Es wird oft betont, wie jemand „trotz der Beeinträchtigung“ sein Leben bewältigt. Darüber hinaus wird in Diskussionen und Beiträgen über Behinderung und Inklusion oft über Menschen mit Behinderung gesprochen, selten jedoch mit ihnen. Durch diese Art von Diskurs bewerten und beurteilen hauptsächlich nicht betroffene Personen das Leben von Menschen mit Behinderungen und reduzieren es dabei auf deren Einschränkungen. Was das für Barrierefreiheit oder zumindest Barrierearmut bei Texten oder Webseiten bedeutet, erfährst du hier.
Warum ist Empowerment-Journalismus wichtig?
Der Empowerment-Journalismus stellt eine Kritik an der gängigen Praxis dar, bei der Journalist:innen oft marginalisierte Gemeinschaften kurzzeitig besuchen, um deren Erlebnisse für eine breitere Öffentlichkeit oder das heimische Publikum zu interpretieren. Dieses Vorgehen wird oft als Fallschirm-Journalismus bezeichnet. Im Gegensatz dazu zielt der Empowerment-Journalismus darauf ab, die Perspektive umzukehren. Hier ist das primäre Publikum jene Gemeinschaft, über die berichtet wird. Der Fokus liegt auf der Zusammenarbeit mit diesen Gemeinschaften, um Inhalte zu erstellen, die aus ihrer Sicht wirklich bedeutsam sind. Ziel ist es, die Gemeinschaften durch die Berichterstattung zu stärken.
Maya Lefkowich und ihre Kolleg:innen identifizieren vier Grundsätze des Empowerment-Journalismus:
- Verantwortungsübernahme (accountability)
- Gegenseitigkeit (reciprocity)
- Zusammenarbeit (collaboration)
- Community-Fokus (local ownership)
In ihrem Fachartikel präsentieren sie drei Projekte, in denen sie versucht haben, diese Prinzipien umzusetzen. Sie teilen sowohl die Erfolge als auch die Herausforderungen, die sie bei der Umsetzung dieser Prinzipien erlebt haben. Lies hier mehr über Empowerment.
Hast du weitere Fragen zum Thema Diversität in den Medien und der Mediengestaltung? Dann findest du die Antworten garantiert in unserem umfangreichen und komplett kostenlosen Lernangebot der HAW. Klick rein und informiere dich über dieses gesellschaftsrelevante Thema!

Diskutiere mit uns über . Bild: Brooke Cagle
27.10.2023 | hoouadmin
HAW Hamburg: Entwickelt mit uns beim Jupitercampus drei Lernangebote
Was ist das Projekt „Zugang für Alle – auf dem Weg zu barrierefreien Lernmaterialien“?
Wir laden euch dazu ein, mit uns gemeinsam zu entdecken, wer die Zielgruppe für das Lernangebot „Zugang für Alle – auf dem Weg zu barrierefreien Lernmaterialien” sein könnte und wie die Beteiligten am liebsten lernen möchten. Ihr lernt in diesem Workshop am 4. November von 10 bis 12 Uhr die HOOU kennen, erfahrt was wir im Rahmen des jeweiligen Projekts umsetzen wollen und tragt dazu bei, dass das Lernangebot richtig gut wird. Wir diskutieren, malen, basteln und entwickeln gemeinsam Visionen für ein zeitgemäßes Lernen mit den drei Schwerpunkten:
- Warum interessiert ihr euch für das Thema des jeweiligen HOOU-Projekts?
- Was wollt ihr dazu lernen?
- Wie wollt ihr lernen?
Was ist das Projekt „Biodiversität und ich“?
Biodiversität und Klimawandel sind die großen gesellschaftlichen Themen unserer Zeit. Doch die Dramatik des Artenverlusts und die Dringlichkeit von Maßnahmen zum Schutz der biologischen Vielfalt sind vielen Menschen in dieser Gesellschaft noch nicht bewusst.
In unserem multimedialen Lernangebot wollen wir ein Verständnis für die komplexen Zusammenhänge in Ökosystemen schaffen. Zudem erstellen wir eine Simulation, mit der verschiedene Faktoren und ihre Wirkung auf das eigene Leben getestet werden können. Lasst uns bei dem Workshop am 4. November von 13 bis 15 Uhr gemeinsam herausfinden, was wir in das Lernangebot aufnehmen müssen.
Was ist das Projekt „klima.kompetent“?
Mit unserem Projekt „klima.kompetent“ wollen wir zukünftige Akteur:innen aus verschiedenen Gesundheitsdisziplinen zu Expert:innen ausbilden. In Form von interaktiven und fallorientierten Materialien sollen sie passgenau dazu ermächtigt werden später den Wissenstransfer in ihrem Beruf leisten zu können. Zu diesem Lernangebot könnt ihr bei dem Workshop am 4. November von 16 bis 18 Uhr beitragen.
Die Workshops im Überblick:
10 bis 12 Uhr: Entwickle gemeinsam mit uns Ideen für das Lernangebot „Zugang für Alle“
13 bis 15 Uhr: Entwickle gemeinsam mit uns Ideen für das Lernangebot „Biodiversität in Gewässern“
16 bis 18 Uhr: Entwickle gemeinsam mit uns Ideen für das Lernangebot „klima.kompetent“

Titelbild: thisisengineering / Unsplash
30.08.2023 | Meena Stavesand
„Mehr Diversität in MINT-Fächern fördert vielfältige Perspektiven und Kreativität“
Mit unserer Reihe „Who is HOOU?“ wollen wir uns vorstellen. Den Anfang macht Dr. Paula de Oliveira Guglielmi, die an der TUHH für die HOOU die Wissenschaftskommunikation verantwortet. Paula ist Ingenieurin und freut sich über viele weibliche Mitstreiterinnen, um die Vielfalt im MINT-Bereich zu erhöhen.
Paula, du bist Ingenieurin – warum hast du dich für ein MINT-Studium entschieden?
Dr. Paula de Oliveira Guglielmi: Eigentlich fiel die Entscheidung für ein MINT-Studium bereits, als ich 14 Jahre alt war. Damals habe ich angefangen, Chemie und Physik in der Schule zu lernen. Diese Fächer haben mich direkt fasziniert. Die Themen machten mir viel Spaß und es fiel mir leicht, sie zu verstehen. Ich wollte unbedingt etwas studieren, das diese beiden Fächer zusammenbringt. Und so habe ich mich für die Materialwissenschaft entschieden. Vorher wollte ich mal Journalismus studieren – daher stammt auch mein Interesse für die Wissenschaftskommunikation.
Warum empfiehlst du anderen – insbesondere Frauen, die dort leider noch unterrepräsentiert sind – MINT-Fächer zu studieren?
Paula: Die MINT-Fächer schaffen die Grundlagen, damit wir unsere Umwelt verstehen. Sie sind sehr vielfältig. Man kann viel mit diesem Wissen machen. Am schönsten finde ich es, wenn Menschen dieses Wissen nutzen, um Sachen zu entwickeln, die entweder unser Leben schöner und bequemer machen oder die Lösungen für aktuelle Herausforderungen bieten. Als Beispiele könnte man die Entwicklungen im Bereich der Medizintechnik und Diagnostik nennen, die uns ermöglichen, länger und gesünder zu leben, oder die Entwicklungen im Bereich des Transportwesens (Flüge und Züge), durch die wir große Distanzen in kurzer Zeit zurücklegen können, um unsere Welt zu entdecken und sich so mit Menschen aus der Ferne zu verbinden. Auch im Feld der erneuerbaren Energien finden sich viele Anwendungsmöglichkeiten, die uns aktuell dabei helfen, die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen. Es macht Spaß, Sachverhalte zu verstehen und neue Sachen zu erfinden und entwickeln!
Aus meiner Erfahrung heraus bin ich fest davon überzeugt, dass es überhaupt keine technische oder MINT-bezogene Aufgabe gibt, die ausschließlich von Männer durchgeführt werden kann. Frauen können dies genauso gut wie Männer. Deswegen sollen sich junge Frauen, die sich für MINT-Fächer interessieren und daran Spaß haben, unbedingt trauen, MINT-Fächer zu studieren. Außerdem würde mehr Diversität in technischen Bereichen vielfältige Perspektiven schaffen und dabei mehr Kreativität fördern.

Was machst du bei uns an der HOOU?
Paula: Mein Schwerpunkt bei der HOOU ist die Wissenschaftskommunikation. Meine Aufgabe besteht darin, neue Strukturen und Formate zu schaffen, die den Wissenschaftler:innen unserer Hochschulen ermöglichen, ihr Wissen und ihre Erfindungen in einer verständlichen Weise an die Gesellschaft weiterzugeben. Das ist eine wichtige Aufgabe, da unsere Gesellschaft heute ständig den immer schnelleren Fortschritten in Wissenschaft und Forschung ausgesetzt ist. Dabei fehlt es vielen Menschen häufig die Zeit oder das Grundlagenwissen, diese Fortschritte gründlich zu verarbeiten und zu verstehen. Hinzu kommt die große Menge an Information, die teilweise unprofessionell über Social-Media-Kanäle verbreitet wird und so oft zu Verwirrungen und Unsicherheiten führt.
Als zentrale Wissenschaftsakteure haben die Hochschulen die Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, durch ihre Fachexpertise und Reputation, die aktuellen Forschungsfortschritte in einer verständlichen Weise zu kommunizieren, um der Bevölkerung dabei zu helfen, sich mit eben jenen Fortschritten besser auseinanderzusetzen und vielleicht auch die positiven Seiten der wissenschaftlichen Entwicklungen wahrzunehmen.
Die Hamburg Open Online University stellt eine hervorragende Schnittstelle zwischen den Hochschulen und der Gesellschaft dar und spielt somit eine entscheidende und strategische Rolle in der Wissenschaftskommunikation. Mir macht dieser Job Spaß, weil man nicht an ein einziges Thema gebunden ist, sondern man viel aus verschiedenen Bereichen lernt, da die Angebote der HOOU so vielfältig sind. Außerdem war es mir als Wissenschaftlerin immer wichtig, meine Forschung so didaktisch und verständlich zu formulieren, dass sie jeder versteht. Jetzt kann ich auch andere dabei unterstützen.