Kategorie: Uncategorized

25.02.2026 | hoouadmin
Warum uns Nachrichten ermüden und wie wir damit umgehen können
Immer mehr Menschen fühlen sich von Nachrichten überfordert. Die Forschung spricht von Nachrichtenmüdigkeit: zu viele Krisenmeldungen, zu wenig Orientierung, oft folgt der Rückzug. Das Lernangebot „News-Life-Balance“ der TU Hamburg und der Hamburg Media School zeigt, warum dieser Zustand entsteht und wie sowohl Mediennutzende als auch Journalist:innen Wege finden können, informiert zu bleiben, ohne auszubrennen. Welche Ursachen dahinterstehen und was sich verändern müsste, erklären Anke Gehrmann und Prof. Christopher Buschow von der Hamburg Media School. Das Interview führte Johanna Rose-Jastram.
Frau Gehrmann, früher schien der Umgang mit Nachrichten klarer geregelt. Was war anders?
Anke Gehrmann: Früher gab es feste Nachrichtenrituale. Da gab es zum Frühstück die Tageszeitung oder die Radiosendung, die fünf oder manchmal auch nur zehn Minuten ging. Die Tageszeitung hat man von A bis Z durchgeblättert und dann war man durch. Oder abends gab es die Tagesschau oder andere Nachrichtensendungen. Die Nachrichten wurden mit einer Verzögerung vorgetragen, von Sprecher:innen, die sehr distanziert waren. Das waren Barrieren oder Distanzmöglichkeiten. Da wusste man genau: Ich bin orientiert, so und so viel muss ich wissen.
Wie unterscheidet sich das von der heutigen Nachrichtenwelt?
Anke Gehrmann: Heute sind die Faktoren ganz andere. Es gibt einen 24/7-Newsflow. Man wird auf allen Kanälen bombardiert. Man scrollt immer weiter, weil die Algorithmen so programmiert sind, dass sie dich möglichst lange halten. Das führt zu totaler Überforderung. Man hat gar keine Zeit mehr, sich zurückzuziehen, zu verarbeiten oder eine Distanz zu finden.
Herr Buschow, warum führt diese Überforderung so oft zu Nachrichtenvermeidung?
Christopher Buschow: Es gibt verschiedene Faktoren, die zu Nachrichtenvermeidung führen. Negative Nachrichten sind ein wesentlicher Treiber, das zeigt die Forschung sehr deutlich. Krisen, Konflikte und Negativität führen dazu, dass Menschen sich überlastet fühlen und keine Selbstwirksamkeit spüren – also keine Möglichkeit, die Situation ein Stück weit zu verändern.

Wissenschaft kurz erklärt: News-Life-Balance
Negative Schlagzeilen, ein endloser News-Stream und Krisen im Dauerlauf: Viele Menschen fühlen sich von Nachrichten überfordert. Der Podcast zum Lernangebot “News-Life-Balance” der Hamburg Open Online Universität erklärt anhand aktueller Forschung, warum Nachrichtenvermeidung entsteht, welche Rolle der Journalismus dabei spielt und wie bewusster Konsum sowie konstruktive Ansätze wieder zu Orientierung führen. Mit Prof. Christopher Buschow und Anke Gehrmann von der Hamburg Media School.
Frau Gehrmann, was passiert, wenn Menschen über längere Zeit fast nur Negatives sehen?
Anke Gehrmann: Das Problem ist: Wenn man so viele negative oder ausschließlich negative Nachrichten hört, rutscht man in eine sogenannte erlernte Hilflosigkeit. Die Menschen kommen in ein Ohnmachtsgefühl: ‚Es ist alles so schlecht, ich kann eh nichts tun.‘ Wenn es immer nur dieses eine Narrativ gibt, schlägt das auf die Stimmung – und viele sagen dann: Damit beschäftige ich mich nicht mehr.
Herr Buschow, eine Pause kann gesund sein. Wo beginnt es problematisch zu werden?
Christopher Buschow: Bei der bewussten Nachrichtenvermeidung ist es oft eine Schutzreaktion. Man sagt: Ich kann das nicht so lange ertragen, ich brauche Pausen ohne Nachrichten, in denen ich Kraft sammeln kann. Viele vermeiden einzelne Themen, vermeiden Nachrichten zu Trump, oder nehmen sich Auszeiten am Wochenende oder abends, schalten Push-Nachrichten ab. Das ist häufig reflektiert. Aber es gibt einen Kipppunkt. Wenn man merkt, dass man eigentlich gar keine Lust mehr auf Nachrichten hat und dauerhaft abschaltet, verliert man den Bezug zu den eigenen Nutzungsroutinen. Und das kann gesellschaftliche Effekte haben: Menschen sind schlechter informiert, treffen schlechtere Entscheidungen und gehen seltener wählen.
Welche Risiken entstehen, wenn viele Menschen sich dauerhaft zurückziehen?
Anke Gehrmann: Studien zeigen klar: Menschen, die Nachrichten vermeiden, sind viel anfälliger für Desinformation und Desinformationskampagnen, weil sie nicht kritisch und fundiert informiert sind. Das ist ein Risiko für die Gesellschaft, weil wir Menschen brauchen, die mündige Entscheidungen treffen. Das ist wichtig für die Demokratie.
Trägt der Journalismus zu diesem Problem bei?
Christopher Buschow: Wir wissen aus der Forschung, dass Negativität zwar zu Erschöpfung und Vermeidung führt, aber gleichzeitig sehr populär ist. Online wird mehr geklickt, wenn Headlines negativer sind. Das hat evolutionsbiologische Gründe: Die schlechte Nachricht war früher überlebenswichtig – der Säbelzahntiger vor der Höhle. Das erklärt, warum negative Nachrichten heute stärker konsumiert werden.
Anke Gehrmann: Und der wirtschaftliche Druck ist enorm. Wenn man eine bestimmte Quote erreichen muss, ist man geneigt, das Bild zu nehmen, das mehr geklickt wird. Das hat nichts mit Sensationslust zu tun, sondern damit, wie das Gehirn funktioniert: Wir klicken das Bild mit dem Feuerball eher an als eine positive Lösungsgeschichte. Und das ist auch das, was wir gelernt haben: „Only bad news are good news“.

Jeder kennt Work-Life-Balance. Aber niemand kennt seine News-Life-Balance. Dabei brauchen wir eine neue Balance zwischen der Nachrichtenwelt und unserem eigenen Leben.Anke Gehrmann, Hamburg Media School
Wenn der Journalismus Teil des Problems ist, wie könnte er Teil der Lösung werden?
Christopher Buschow: Wir können nichts an den Krisen ändern. Aber der Journalismus muss nicht ohne konstruktive Perspektive berichten. Es geht nicht darum, das Positive zu betonen. Aber eine Lösungsorientierung, ein Weg nach vorne, kann Menschen zurückholen, die sonst sagen: Es ist immer alles negativ. Diese Geschichten zeigen Selbstwirksamkeit: Du kannst etwas ändern, auch im kleinen Wirkbereich. Das ist wichtig.
Frau Gehrmann, Sie haben das Konzept der News-Life-Balance entwickelt. Was bedeutet das?
Anke Gehrmann: Jeder kennt Work-Life-Balance. Aber niemand kennt seine News-Life-Balance. Dabei brauchen wir eine neue Balance zwischen der Nachrichtenwelt und unserem eigenen Leben. Die Frage ist: Wie können wir gut informiert bleiben und gleichzeitig gesund und stabil bleiben. Auch als Journalist:innen? Das Lernangebot hilft, genau das herauszufinden.
Wie sieht Ihre eigene News-Life-Balance aus?
Anke Gehrmann: Es ist kein Rezept, sondern ich versuche, mich immer besser kennenzulernen: Wie reagiere ich auf Nachrichten, im Vergleich zu anderen? Das ist individuell. Und es geht viel ums Nervensystem: Bin ich in Sicherheit? Wenn ich Nachrichten schaue und merke, dass mich etwas belastet, setze ich bewusst etwas dagegen. Das kann ein Spaziergang sein. Oder etwas ganz Simples wie: Ich schaue mich im Raum um und stelle fest, dass ich hier gerade safe bin.

News-Life-Balance: Wie wir informiert bleiben, ohne auszubrennen
Negative Schlagzeilen, ein endloser News-Stream und Krisen im Dauerlauf: Viele Menschen fühlen sich von Nachrichten überfordert. Der Podcast zum Lernangebot “News-Life-Balance” der Hamburg Open Online Universität erklärt anhand aktueller Forschung, warum Nachrichtenvermeidung entsteht, welche Rolle der Journalismus dabei spielt und wie bewusster Konsum sowie konstruktive Ansätze wieder zu Orientierung führen. Mit Prof. Christopher Buschow und Anke Gehrmann von der Hamburg Media School.
Strategien für einen gesunden Nachrichtenumgang
Wenn ihr euch tiefer mit dem Thema beschäftigen wollt: Das Lernangebot „News-Life-Balance“ der Hamburg Open Online University führt durch die zentralen Ursachen von Nachrichtenmüdigkeit, zeigt anhand aktueller Forschung, wie Mediennutzung und Nervensystem zusammenhängen, und bietet Übungen, Reflexionsimpulse und praktische Strategien für einen gesünderen Umgang mit Nachrichten.
Ihr findet das gesamte Lernangebot mit Hintergrundmaterial und interaktiven Elementen auf hoou.de.

Bild: Vitaly Gariev / Unsplash
18.02.2026 | Meena Stavesand
Der Mehrwert entscheidet: Lehren und Lernen sortieren sich neu
Was bedeutet hybride Lehre heute? Ellen Pflaum, Teamleiterin der Hamburg Open Online University an der HAW Hamburg, macht klar: Es gibt viele richtige Antworten. Jede Hochschule findet ihren eigenen Mix aus Digital und Präsenz. Doch ihre zentrale Botschaft lautet: Nicht die Form entscheidet, sondern der Nutzen für die Studierenden. Dieser Beitrag stammt aus der Broschüre „10 Gedanken zu hybrider Lehre und OER“ der HAW Hamburg.
Ellen Pflaum bringt langjährige Erfahrung in der digitalen Bildung mit. Wir sprechen mit ihr über ihre persönliche Motivation, die Entwicklung hybrider Lehrformate und die Lehren aus zehn Jahren offener Bildung an der Hamburg Open Online University (HOOU).
Was motiviert dich, offene und digitale Bildung voranzutreiben?
Ich habe schon immer gerne gelernt. Als Zehnjährige schrieb ich mir alles aus einem Länderlexikon über Dänemark ab, weil mich das Land faszinierte. Dann kam das Internet, und plötzlich war der Zugang zu Informationen viel einfacher. Alles, was ich wissen wollte, war mit einem Klick verfügbar. Das hat mich auch beruflich geprägt. Für mich war klar: Diese Offenheit sollte selbstverständlich sein.
Als die HOOU vor über zehn Jahren startete, war das für mich der Grund, mitzumachen. Denn hier ging es um mehr als nur frei zugängliche Informationen. Ich konnte Lernangebote schaffen, die Menschen miteinander verbinden und ihnen helfen, gemeinsam Probleme zu lösen. Genau das unterscheidet offene Bildung von bloßen Informationen: Wir setzen Inhalte in Kontexte und ermöglichen echten Austausch.
Und ehrlich gesagt bin ich auch aus egoistischen Gründen dabei: Ich lerne sehr gerne und wollte eine Welt schaffen, in der ich das gut machen kann.
Was bedeutet hybride Lehre heute?
Den Begriff „Hybride Lehre“ gab es im deutschsprachigen Raum vor zehn Jahren noch nicht. Damals sprachen wir von Blended Learning, wenn wir analoge und digitale Formate kombinierten.
Corona hat die hybride Lehre geprägt – zunächst in einem sehr spezifischen Sinn: Studierende nahmen vor Ort im Hörsaal und gleichzeitig online von zu Hause aus an Veranstaltungen teil. Wir mussten Gruppen verkleinern, um Ansteckungen zu vermeiden. So entstand die klassische hybride Lehre.
Heute verwenden wir den Begriff breiter, ähnlich wie früher Blended Learning. Mittlerweile bezeichnen wir alles als hybride Lehre, was verschiedene Lehr- und Lernformen miteinander kombiniert – manchmal sogar über den reinen Digital-Analog-Kontext hinaus.
War Corona ein Wendepunkt für digitale Bildung?
Ja, definitiv. Vor Corona mussten wir ständig den Mehrwert digitaler Lehre gegenüber Präsenzlehre rechtfertigen. Mit der Pandemie wurde digitale Lehre plötzlich zur Notwendigkeit – die Mehrwertfrage stellte sich nicht mehr. Digitale Lehre wurde selbstverständlich in der Hochschullandschaft.
Nach der Pandemie entwickelten sich zwei unterschiedliche Richtungen: Die einen setzten digitale Formate selbstverständlich fort, weil sie erkannten, dass diese eine eigene Berechtigung haben und nicht erst einen Mehrwert beweisen müssen. Die anderen wollten zurück zur reinen Präsenzlehre.
Das Wichtigste aber: Die Menschen haben begonnen, sich bewusst mit dem Thema auseinanderzusetzen. Statt pauschal nach dem Mehrwert zu fragen, überlegen Lehrende nun individuell, was ihnen und den Lernenden wichtig ist. Sie treffen bewusste Entscheidungen auf Basis verschiedener Faktoren.
Heute verschwimmen die Grenzen zwischen den beiden Lagern. Ich selbst gehe für bestimmte Situationen gerne zurück in Präsenz – etwa wenn wir wirklich kreativ arbeiten oder intensiv diskutieren wollen. Aber digitale Gespräche und Veranstaltungen sind bei fast allen Hochschulmitarbeitenden zum Standard geworden. Wir diskutieren nur noch über das richtige Ausmaß.
Es geht nicht mehr um die Grundsatzdiskussion, ob man digital lehren sollte. Stattdessen bekommen wir spezifische, detaillierte Fragen: Wie machen wir es gut? Welche Methoden funktionieren?
Ellen Pflaum, HAW Hamburg
Die HOOU ist 2025 zehn Jahre alt geworden. Wie hat sie sich in dieser Zeit entwickelt?
Der größte Wandel: Wir mussten früher viel erklären. Vor zehn Jahren wussten die meisten Menschen nicht, was offene Bildung ist oder warum wir digital arbeiten. Wir hatten fast Einhorn-Charakter – etwas Exotisches, Ungewöhnliches. Heute ist das anders. Jede:r versteht, was digitales Lernen bedeutet. Die HOOU ist selbstverständlich geworden.
Auch die Fragen haben sich verändert. Es geht nicht mehr um die Grundsatzdiskussion, ob man digital lehren sollte. Stattdessen bekommen wir spezifische, detaillierte Fragen: Wie machen wir es gut? Welche Methoden funktionieren?
Strukturell hat sich wenig geändert: Wir haben weiterhin sechs Hamburger Hochschulen und Institutionen, eine Geschäftsstelle und eine technische Infrastruktur, die wir kontinuierlich verbessern. Aber die Qualität der Angebote ist deutlich gestiegen. Lehrende haben über die Jahre Erfahrung gesammelt, und die Pandemie gab einen zusätzlichen Entwicklungsschub.
Besonders schön finde ich, wie sich die Vernetzung zwischen den Hochschulen entwickelt hat. Früher arbeitete jede Hochschule für sich, teilweise sogar jede Fakultät isoliert. Lehrende haben für dasselbe Grundlagenseminar Mathematik dieselben Inhalte unabhängig voneinander erarbeitet. Heute kooperieren sie über Hochschulgrenzen hinweg. Wir haben beispielsweise zwei Fakultäten mit ähnlichen Projektideen zusammengebracht und ihnen ein gemeinsames Budget gegeben. So entstand ein stärkeres Angebot, das das Beste aus beiden Perspektiven vereint. Das sind zwar nur punktuelle Erfolge, aber sie freuen uns. Das Hochschulsystem revolutioniert haben wir damit aber noch nicht.
Welche Chancen und Herausforderungen siehst du für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass Lehrende unsere Materialien viel intensiver nutzen. Das würde ihnen Zeit sparen, die sie in andere wichtige Aufgaben investieren könnten, statt immer wieder dieselben Grundlagenthemen neu zu erarbeiten.
Für Studierende liegt die große Chance darin, über den Tellerrand ihres Studiengangs zu schauen. Wir docken mit unseren Angeboten an Themen verschiedener Studiengänge an. Wenn Studierende unsere Materialien zur Selbstlernmöglichkeit nutzen, erhalten sie neue Perspektiven auf ihre Themen. Eine HAW-Studierende kann beispielsweise Angebote der TU Hamburg, der Hochschule für bildende Künste oder der HafenCity Universität nutzen und dadurch völlig andere fachliche Sichtweisen kennenlernen.
Warum ist das wichtig?
Das halte ich für entscheidend, um die komplexen Probleme unserer Zeit zu lösen. Wir dürfen nicht nur aus einer Perspektive auf die Welt schauen, sondern müssen verschiedene Disziplinen, Menschen und Sichtweisen einbeziehen. Die HOOU bietet genau diese Vielfalt auf einem Serviertablett. Studierende und Lehrende können sie leicht nutzen, für sich reflektieren und auf ihren eigenen Kontext übertragen.
Die größte Herausforderung bleibt: Wir müssen die Schnittstellen zwischen formalen Bildungsangeboten und frei verfügbaren Inhalten besser gestalten. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Als ich noch studierte, hatte ich keine Zeit für Angebote ohne ECTS-Punkte. Ich arbeitete nebenbei und engagierte mich ehrenamtlich. Mein Studium bot mir Freiräume, aber einfach mal ein Online-Angebot zu nutzen, weil es thematisch passt? Realistisch war das nicht.
Wir müssen also Mechanismen entwickeln, die es Studierenden ermöglichen, unsere Angebote zu nutzen. Gleichzeitig müssen wir Lehrende befähigen, solche Angebote kompetent in ihre Lehre einzubinden. Wir brauchen Anreize für alle Beteiligten, damit formale Lehre und HOOU-Angebote besser zusammenspielen.
Wenn hybride Lehre ein Ort wäre – wie würdest du ihn beschreiben? Welche drei Begriffe wären wichtig?
Ich stelle mir ein offenes Haus vor. Überall gibt es Türen, Fenster und Treppen. Ich kann überall hingehen, reinschnuppern, bleiben oder weitergehen – mit unzähligen Optionen und ohne Zwänge.
Dieses Haus ist bunt. Es vereint verschiedene Disziplinen, Perspektiven und Fachkulturen. Menschen aus der Praxis, aus Organisationen und aus der Bevölkerung gestalten es gemeinsam. Diese Vielfalt macht es lebendig.
Und es steht solide. Das ist mir wichtig. Wir arbeiten als Hochschulen wissenschaftlich fundiert. In einer Zeit, in der viele nicht faktenbasierte Behauptungen kursieren, zählt das. Wir bauen auf wissenschaftlicher Erfahrung und jahrzehntelanger Lehrpraxis auf – ohne dabei starr zu werden. Wir haben ein solides Fundament aus Wissenschaft, Forschung und Lehre. Auf diesem Fundament entfalten wir offene, bunte und kreative Möglichkeiten.

Illustration: Charlotte Hintzmann
11.02.2026 | Meena Stavesand
Zusammen Gemeinwohl-Ökonomie lernen: Warum sich neun Menschen jede Woche trafen
Kann Wirtschaft mehr als Profit? Neun Menschen haben sich zehn Wochen lang mit genau dieser Frage beschäftigt – in einem Learning Circle zur Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) der HAW Hamburg. Zwischen Brauerei-Besuch, Stadionführung und Workshops ist dabei so viel passiert, dass es jetzt eine zweite Runde gibt. Ab März 2026 kannst du dabei sein.
Was wäre, wenn wirtschaftlicher Erfolg nicht am Gewinn gemessen würde, sondern daran, wie sehr ein Unternehmen Menschen, Gesellschaft und Umwelt stärkt? Genau das ist die Idee der Gemeinwohl-Ökonomie: ein Wirtschaftsmodell, das Kooperation statt Konkurrenz in den Mittelpunkt stellt. Unternehmen erstellen dafür eine Gemeinwohl-Bilanz, die zeigt, wie sie zu nachhaltigem Wirtschaften beitragen – von Menschenwürde über ökologische Nachhaltigkeit bis hin zu Transparenz und Mitbestimmung.
Klingt spannend, aber auch komplex? Genau deshalb gibt es einen kostenlosen Online-Kurs zur Einführung in die GWÖ der HAW Hamburg. Und genau diesen Kurs hat eine Gruppe von November 2025 bis Januar 2026 gemeinsam in einem Learning Circle bearbeitet.
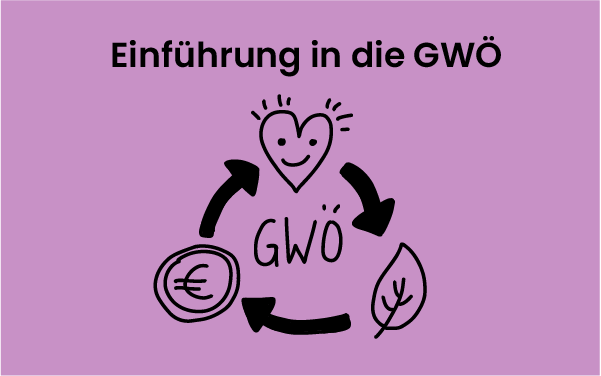
Einführung in die Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ)
Lern mehr über die Gemeinwohl-Ökonomie als innovative Wirtschafts- und Gesellschaftsform. Hinterfrage mit uns traditionelle Erfolgsmaßstäbe wie Gewinnmaximierung und lass uns unsere Gesellschaft gleichermaßen auf der Basis von Werten wie Solidarität, Gerechtigkeit, ökologischer Nachhaltigkeit und Mitbestimmung gemeinwohlorientiert gestalten.
Was ist ein Learning Circle?
Vielleicht fragst du dich: Warum nicht einfach allein den Online-Kurs durcharbeiten? Die Antwort: weil gemeinsam Lernen mehr bringt. Das Konzept der Learning Circles kommt von der Peer 2 Peer University (P2PU) und funktioniert so: Menschen, die sich für ein Thema interessieren, treffen sich regelmäßig in kleinen Gruppen, arbeiten gemeinsam mit offenen Lernmaterialien (Open Educational Resources/OER) und tauschen sich aus. Eine moderierende Person – der sogenannte Facilitator – hält den Prozess zusammen, ist aber keine Lehrperson. Das Prinzip: voneinander und miteinander lernen.
Learning Circles sind ein wichtiger Baustein im Bereich Open Education. Sie bringen Online-Lernen und persönliche Begegnung zusammen und zeigen, dass Bildung am besten funktioniert, wenn sie gemeinschaftlich stattfindet.
So lief der erste Learning Circle zur GWÖ
Von Anfang November 2025 bis Mitte Januar 2026 trafen sich die neun Teilnehmenden einmal pro Woche. Moderiert wurde der Circle von Gabi Fahrenkrog (TIB Hannover) und Henry Wehrenberg (greenpulse.io). Die Kooperation mit der Hamburger Fernhochschule (HFH) machte das Ganze möglich.
Auftakt in der Brauerei Wildwuchs
Los ging’s nicht im Seminarraum, sondern in der Brauerei Wildwuchs – einem Unternehmen, das bereits GWÖ-zertifiziert ist. Nach einer Brauereiführung lernten sich die Teilnehmenden kennen, bekamen eine Einführung in die Grundprinzipien der GWÖ und erfuhren, wie der Learning Circle ablaufen würde. Außerdem stellte Gabi Fahrenkrog ein Taskcards-Board bereit, über das sie alle Materialien, Links und Infos teilte.
Von den SDGs zur Gemeinwohl-Bilanz
In den folgenden Wochen arbeitete sich die Gruppe durch die Kursmodule: von den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals/SDGs) der Vereinten Nationen über das Konzept der GWÖ bis hin zur Gemeinwohl-Bilanz für Unternehmen und Gemeinden. Dabei haben die Teilnehmenden nicht nur gelesen und diskutiert – Henry Wehrenberg brachte als GWÖ-Experte Praxisbeispiele ein und erklärte die Bewertungsskala der GWÖ-Bilanzierung.
Praxis pur: Interviews und Fokusberichte
Ein Highlight des Learning Circles war der Praxisteil. Die Teilnehmenden lernten den sogenannten Fokusbericht kennen, der Unternehmen auf dem Weg zur GWÖ-Zertifizierung unterstützt. Anhand von 40 Impulsfragen analysierten sie ein Gastro-Beispiel; einige führten anschließend selbst Interviews mit Unternehmen, um eigene Fokusberichte zu erstellen. Eine echte Chance, das Gelernte direkt in die Praxis zu bringen.
Zusätzlich berichtete Harald Kother von IBK Kulturtours, dessen Unternehmen bereits GWÖ-zertifiziert ist, aus erster Hand von seinen Erfahrungen mit der Bilanzierung.
Abschluss im Millerntor-Stadion
Der krönende Abschluss: eine Führung durch das Millerntor-Stadion des FC St. Pauli – ebenfalls ein Verein, der sich aktiv mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Bei einem abschließenden Impuls wurden die Nachhaltigkeitsbemühungen des Vereins vorgestellt.
Was die Gruppe unterwegs gelernt hat – nicht nur über GWÖ
Nicht alles lief von Anfang an reibungslos, und genau das gehört zu einem ehrlichen Lernprozess dazu. Der erste Raum in der Zentralbibliothek der Bücherhallen war schlicht zu klein für produktives Arbeiten. Die Lösung: Ab der vierten Sitzung stellte die HAW Hamburg einen größeren Konferenzraum zur Verfügung. Außerdem zeigte sich, dass der Austausch zwischen den Treffen wichtig war – die Teilnehmenden organisierten sich selbst in Tandems und Arbeitsgruppen und vernetzten sich per E-Mail.
Das zeigt, was Learning Circles besonders macht: Die Gruppe gestaltet ihren Lernprozess aktiv mit.
Jetzt kommt die zweite Runde: du kannst dabei sein!
Das Feedback war eindeutig: Die Kombination aus Theorie, Praxis und Gemeinschaft hat überzeugt. Ab März 2026 startet deshalb der zweite Learning Circle zur Gemeinwohl-Ökonomie der HAW Hamburg. Diesmal sollen die Inhalte des ersten Kurses vertieft und gemeinsam offene Bildungsmaterialien (OER) für den Einsatz in Schulen und Unterricht entwickelt werden.
Die Eckdaten:
- Zeitraum: März bis Juni 2026
- Termine: 02.03. | 16.03. | 30.03. | 13.04. | 27.04. | 11.05. | 08.06. | 15.06.
- Ort: HOOU an der HAW Hamburg, Jungestraße 10, 6. OG, 20535 Hamburg
- Kosten: Keine – die Teilnahme ist kostenfrei
- Anmeldung: Per E-Mail an hoou@haw-hamburg.de
Alle Details findest du auf der Veranstaltungsseite.
Du willst dich schon vorab ins Thema einlesen? Dann starte mit dem kostenlosen Online-Kurs zur GWÖ auf der HOOU-Lernplattform.

Bild: Roman Synkevych / Unsplash
03.02.2026 | hoouadmin
Die Macht der Böden – Warum Böden wichtiger für uns sind, als wir denken
Böden sind wahre Meister, wenn es darum geht, Wasser zu speichern, Schadstoffe zu filtern und Pflanzen mit Nährstoffen zu versorgen. Sie bilden die Grundlage für unsere Ernährung, sorgen für sauberes Trinkwasser und können sogar Auswirkungen der Klimakrise abmildern. Trotzdem wird ihre Wirkung regelmäßig unterschätzt. Warum sich das ändern muss, was sie an Böden fasziniert und wie wichtig gesunde Böden für unser Ökosystem sind, erklärt Jana Rose, Wissenschaftlerin an der TU Hamburg, im Interview. Sie hat mit ihrem Team das Lernangebot „Good soil, good future“ erstellt. Das Interview führte Stefanie Eisenreich.
Jana, warum sollten wir uns mehr für unsere Böden interessieren?
Wir alle werden direkt vom Zustand des Bodens beeinflusst. Wenn wir kontaminierten Boden haben, kontaminieren wir uns selbst. Wenn der Boden Schadstoffe hat, dann sind diese im Wasser, das wir trinken oder in den Lebensmitteln, die wir essen. Ich kenne ein Beispiel, bei dem ein Chemiekonzern große Landstriche mit Cadmium kontaminiert hat, und die Landwirte, die dort anbauten, hatten sehr hohe Konzentrationen von Cadmium in ihren Karotten und Kartoffeln. Die Menschen haben unwissentlich über eine Generation lang kontaminierte Lebensmittel gegessen. Der direkte Bezug ist für jeden gegeben.

good soil, good future - Healthy soil regenerates resources
Fruit and vegetables nowadays contain fewer nutrients than in the past. This is because soils are severely degraded and provide plants with fewer nutrients. Conventional agricultural practices not only degrade the soil and reduce its fertility but also pollute water bodies. The “good soil, good future” course explains the methods that can be used to improve this condition and how they affect various soil parameters such as water storage capacity and nutrient content. It also suggests simple experiments you can carry out to check and improve soil conditions, whether in your houseplants, garden, or field.
Was fasziniert dich am meisten am Thema Boden?
Während meiner Bachelorarbeit habe ich mich intensiv mit Lehmsteinen beschäftigt. Mich begeisterte der Gedanke, dass man von Materialien wegkommt, die nur Müll verursachen. Trotz des deutlichen Rückgangs machten zum Beispiel im Jahr 2023 die Bau- und Abbruchabfälle mit knapp 200 Millionen Tonnen weiterhin den Großteil des Gesamtabfallaufkommens aus (52 %). Lehmsteine hingegen werden aus Boden hergestellt. Sie können einfach in Wasser eingeweicht werden, lösen sich auf und sind somit wiederverwendbar. Neben der Nutzung von Boden als Baumaterial, ist das Faszinierendste jedoch, dass er die Grundlage für unsere Lebensmittel und für sauberes Wasser ist. Leider vergessen wir oft, dass der Boden unser Fundament ist und behandeln ihn wie Dreck.
Und trotzdem bekommt der Boden viel zu wenig Aufmerksamkeit.
Ja, es werden Millionen investiert, um Produkte zu vermarkten – für den perfekten „Crunch“ oder die perfekte Kombination aus süß, salzig, crunchy und weich, wie bei Oreo-Keksen. Aber es wird kein Marketing für eine gesunde Banane gemacht. Ähnlich ist es in der Landwirtschaft: Es wird viel Geld in die Erforschung der Effekte agrochemischer Produkte gesteckt. Natürliche Heilquellen wie Kurkuma aber können nicht patentiert werden, und Firmen können damit kein Geld verdienen. Wir haben jedoch mit unserem Projekt Glück, dass wir von Wasserversorgern finanziert werden, deren einziger Fokus sauberes Trinkwasser ist und die kein kommerzielles Verkaufsinteresse haben.
In deinen Forschungen geht es auch um unsere Trinkwasserversorgung. Wir hören oft von drohenden Wasserkrisen – auch wegen sinkender Grundwasserspiegel. Wie ordnest du das ein?
Ich nutze gerne die Anekdote eines Klimaforschers, der sagte: Eine Tasse steht am Rand eines Tisches im Gleichgewicht. Wenn wir sie immer weiterschieben, fällt sie irgendwann runter und zerspringt in Splitter. Sie ist dann zwar wieder im Gleichgewicht, aber es ist ein anderes Gleichgewicht als vorher. Das ist vergleichbar mit dem Klimawandel. Wir müssten jetzt extrem viel machen, um zu verhindern, dass die Tasse herunterfällt. In der Region unseres Forschungsprojekts sehen wir auf jeden Fall, dass die Grundwasserspiegel sinken, und das ist ein Problem, das es überall auf der Erde gibt. Wir denken immer, Grundwasser ist endlos vorhanden und Wasser gibt es überall, aber das stimmt nicht. Süßwasser ist eine endliche Ressource.

good soil, good future – Podcast
Boden und Wasser hängen enger zusammen, als viele denken. Kann der Boden Wasser und Nährstoffe gut aufnehmen, bleiben sie im natürlichen Kreislauf. Ist er jedoch geschwächt, werden Stoffe ausgewaschen und gelangen in Flüsse, Seen oder ins Grundwasser. Besonders Rückstände aus Düngemitteln wie Nitrat können dort Umwelt, Tiere und auch uns Menschen belasten. Im „Wissenschaft kurz erklärt”-Podcast „Guter Boden, gutes Wasser” bekommst du einen verständlichen Überblick über diese Zusammenhänge. In einem Gespräch mit zwei Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis erfährst du, warum Böden in gutem Zustand die Grundlage für sauberes Trinkwasser sind – und welche einfachen Schritte du selbst im Alltag gehen kannst, um Boden und Wasser zu schützen.
Du sprichst in eurer Podcastfolge mit dem Vorstand des bayrischen Trinkwasserschutzes Oberpfalz über steigende Nitratwerte im Grundwasser durch Überdüngung. Wie hängt das mit dem sinkenden Grundwasserspiegel zusammen?
Wenn wir weniger Wasser haben, aber den gleichen Schadstoffeintrag, dann haben wir umso mehr Schadstoff im Wasser. Das Herausfiltern dieser Stoffe verursacht sehr hohe Kosten. Wasserversorger vermeiden es deshalb, wenn es nicht gesetzlich vorgegeben ist. Das bedeutet, viele Stoffe bleiben dann im Grundwasser und kontaminieren in der Folge unser Trinkwasser. Deshalb sind solche Trinkwasserkooperationen wie die in Bayern ein wichtiger Teil der Lösung.
Laut Umweltbundesamt sind etwa 45 Prozent aller Siedlungs- und Verkehrsflächen in Deutschland versiegelt, also bebaut, asphaltiert oder anderweitig befestigt. Welche Rolle spielt das für den Boden und unser Trinkwasser?
Flächenversiegelung ist die Vollkatastrophe für den Boden. Es wird ihm sozusagen die obere Haut abgeschnitten. Er kann nicht mehr atmen. Wir zerstören damit alles, was sich darunter befindet. Insbesondere in Städten führt Versiegelung dazu, dass wir keine Grundwasserauffüllung mehr haben. Das Wasser versickert nicht nach unten, sondern geht in die Kanalisation, wird gereinigt und fließt in die Flüsse und dann ins Meer. Das saubere Trinkwasser ist damit weg und kann nicht in den Kreislauf zurückkehren. Versiegelung führt auch zu einem Temperaturanstieg – in Städten haben wir ein Mikroklima mit bis zu 2 Grad mehr. Wir zerstören das komplette Habitat für Mikroorganismen und Vögel.
Welche Schritte müssten wir gehen, um eine Veränderung einzuleiten?
Als Erstes muss ein Bewusstsein dafür entstehen. Wir sollten nicht versuchen, besser als die Natur zu sein, indem wir irgendwelche Produkte entwickeln, sondern die Natur nachahmen. Ich glaube, wir haben eigentlich alle Lösungen schon parat, wir wenden sie nur nicht an. Im Alltag können wir auf individueller Ebene aber alle sehr leicht Dinge tun, die den Boden und unser Trinkwasser schützen. Wir können Wasser sparen, im eigenen Garten oder vor dem Haus Flächenversiegelung vermeiden, mit Wurmboxen dazu beitragen, die Nährstoffe ihrem natürlichen Kreislauf zurückzuführen, auf richtiges Recycling achten oder auch die ein oder andere Jeans weniger kaufen. All unsere Konsumentscheidungen tragen letztlich auch dazu bei, wie gut unsere Trinkwasserversorgung ist.
Über Jana Maria-Magdalena Rose
Jana Maria-Magdalena Rose forscht an der TU Hamburg in Kooperation mit der Hamburg Open Online University zum Thema Bodengesundheit. Jana studierte Bau- und Umweltingenieurwesen und wollte ursprünglich Bauingenieurin werden. Später kam sie zur Hydrogeologie, um der Geschichte (und damit auch ihrer Faszination) von Böden auf den Grund zu gehen. Derzeit widmet sich Jana in ihrer Promotion dem Zusammenhang zwischen Bodenbearbeitung und dem im Boden vorherrschenden Mikrobiom.

Bild: Vitaly Gariev / Unsplash
23.01.2026 | Meena Stavesand
Hybride Lehre und OER an Hochschulen – 10 Gedanken im Countdown
Lehrende im Hörsaal, Studierende am Bildschirm. Oder umgekehrt. Oder ganz anders. Hybride Lehre hat viele Gesichter – und genau das ist ihre Stärke. In unserer neuen Broschüre öffnen fünf Projekte der HAW Hamburg ihre Werkstatt und Expert:innen teilen ihr Wissen. Am Ende steht eine Erkenntnis, die alles zusammenhält: Es geht nicht um die perfekte Methode, sondern um den Mehrwert für die Lernenden.
Wir haben zehn Impulse gesammelt – zu Technik und Recht, zu Barrierefreiheit und Diversität, zu OER und interkultureller Zusammenarbeit. Keine trockene Theorie, sondern Praxisberichte, Checklisten und Interviews mit Menschen, die hybride Lehre jeden Tag gestalten.
Unser Countdown startet bei 10 und arbeitet sich zur großen Frage vor: Was macht hybride Lehre eigentlich aus? „Ein offenes Haus, bunt, mit solidem Fundament“ – so beschreibt Ellen Pflaum, Teamleiterin der HOOU@HAW Hamburg hybride Lehre. Was sie damit meint, ist der rote Faden dieser Broschüre.
Aber der Reihe nach.
10 – Gemeinsam lernen in der globalisierten Welt
Wie gelingt Zusammenarbeit, wenn alle unterschiedlich ticken – kulturell, fachlich, räumlich? Die „EduBoxen“ machen interkulturelle Kommunikation zur persönlichen Entdeckungsreise. Drei aufeinander aufbauende Module führen von den Grundlagen über virtuelle Teamarbeit bis zum Design Thinking. Das Besondere: Das Blended-Learning-Konzept verbindet Selbstlernphasen mit Lerntagebüchern, Online-Austausch und Präsenz-Workshops. Lehrende erhalten fertige Manuals, um die Module direkt einzusetzen.
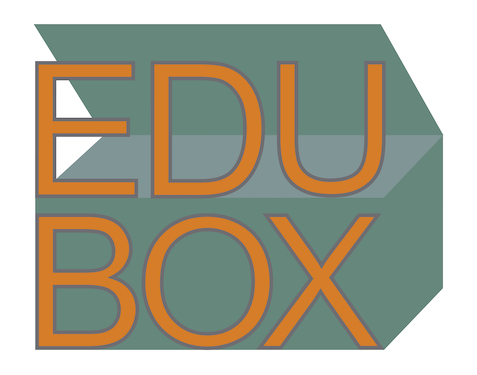
EduBoxes
Here you will find original and innovative material, wich provides new perspectives on culture while analysing and explaining their consequences for intercultural business relationships. Currently there are three lesson areas: 1. Culture, a new perspective includes sessions on ‘Culture, a critical review’; ‘Multi-collectivity as a concept’; ‘Cultural reflexivity’ and ‘Synergy is not for free’ 2. Communicating in diverse contexts comprises a range of material on the ‘Basics of intercultural communication’ and ‘Language and culture’ 3. Social and business networks and relations focuses on ‘Families as primary social networks’; ‘Social relations-a network perspective’ and ‘Basics of a social network analysis’. While you are welcome to use the texts, videos, presentations etc. in your own lessons, we would be grateful if you would cite this site as the source (as well as the author of the work). We view ourselves as an open community, so please feel free to send us your own material (see contact page): This site is evolving!
9 – Rechtsfragen zu hybrider Lehre: Was ist erlaubt?
Darf ich meine Vorlesung aufzeichnen, wenn Studierende zu sehen sind? Welche Lizenz passt zu meinem Material? Und was, wenn ich fremde OER einbauen will? HAW-Juristin Andrea Schlotfeldt sortiert den Paragraphen-Dschungel – verständlich, praxisnah und mit konkreten Empfehlungen. Von Datenschutz über Urheberrecht bis zur richtigen CC-Lizenz – hier findet ihr Antworten auf eure Fragen.
8 – Diskriminierung erkennen, Lehre verändern
Wie werden Lehrveranstaltungen wirklich inklusiv? „Diversify!“ macht Antidiskriminierung greifbar. Die interaktive Plattform verbindet Medienanalyse mit Selbstreflexion und zeigt, wie diskriminierende Muster in Bildern, Sprache und Strukturen wirken. Studierende erkunden eigenständig Themen wie Klassismus oder Rassismus, diskutieren ihre Erkenntnisse und entwickeln Handlungsstrategien. Mit Privilegien-Check, Videomaterial und praktischen Übungen.

Diversify
Die OER Diversify! sollte als ein Startpunkt verstanden werden, sich struktureller Diskriminierung, der Rolle der Medien und der Verantwortung der Lehre anzunähern.
7 – Digitale Barrierefreiheit trifft OER
Offene Bildung für alle – das klingt gut. Aber was bedeutet es konkret? Katrin Bock von der TU Hamburg zeigt, warum Barrierefreiheit und OER zusammengehören. Beide wollen dasselbe: niedrigschwelligen, gleichberechtigten Zugang zu Bildung. Barrierefreiheit ist dabei kein nettes Extra, sondern gesetzlich verankert und ein Qualitätsmerkmal. Der Beitrag räumt mit Vorurteilen auf und macht Mut: Der Aufwand lohnt sich, aber niemand muss alles alleine schaffen.
6 – Selbst-Supervision für Zwischendurch
Eine schwierige Seminarsituation, ein zähes Meeting, eine gelungene Workshop-Session – aber keine Zeit, darüber nachzudenken? „LEADR“ schafft Abhilfe mit Online-Tools zur strukturierten Selbstreflexion. Die Leitfäden basieren auf der Themenzentrierten Interaktion und helfen, die eigene Leitungspraxis weiterzuentwickeln. Für alle, die Gruppen lebendig und wirkungsvoll führen wollen.
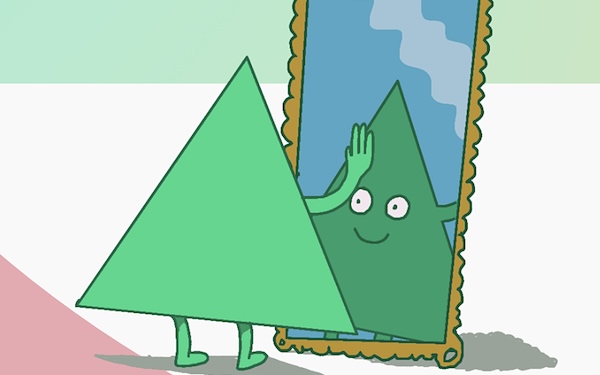
LEADR - Leadership with Reflection (Deutsche Version)
Woran lag es, dass meine Veranstaltung gut ging oder auch nicht? Entwickle durch Reflexion deine Leitungskompetenz für lebendiges Arbeiten mit Gruppen.
5 – OER braucht Struktur, keine Superheld:innen
Lehrende sollen Expert:innen für ihr Fach sein und didaktisch fit, aber müssen sie auch noch Urheberrecht, Technikstandards und Metadaten beherrschen? Nein, sagt Bildungsexperte Jöran Muuß-Merholz. Der Schlüssel liegt in der Arbeitsteilung: Wenn jede:r das macht, was sie oder er am besten kann, entstehen OER, die wirklich funktionieren. Seine Vision für die Zukunft: In zehn Jahren wird niemand mehr bemerken, dass Materialien offen lizenziert sind – weil es einfach Standard ist.
4 – Wenn Studierende zu Lehrenden werden
Wer könnte Studierenden besser erklären, wie das Studium funktioniert, als andere Studierende? Beim „DigitalCampus“ produzieren mehrsprachige Teams Lernmaterialien zu überfachlichen Themen – von Studienfinanzierung bis Selbstmanagement. Die Formate reichen von Videoclips über Podcasts bis zu interaktiven H5P-Modulen.

Digital Campus
Willkommen auf dem Digital Campus, der Plattform, die alle Aspekte des studentischen Lebens vereint.
3 – Hybrid ohne Chaos: Die Technik-Checkliste
Akku leer, Chat explodiert, Mikro auf stumm – hybride Lehre kann technisch schnell zum Stressfaktor werden. Muss sie aber nicht. Unsere Checkliste führt chronologisch durch alle kritischen Punkte: Was muss eine Woche vorher passieren? Was 15 Minuten vor Beginn? Und wie behalte ich während der Veranstaltung den Überblick? Dazu gibt’s Tipps für hybride Tools – und das wichtigste Mantra: Jede Art der hybriden Lehre ist besser als keine.
2 – Von der Forschung zum eigenen Unternehmen
Aus der eigenen Forschung eine Gründungsidee entwickeln? „Science2Startup“ zeigt, wie’s geht. Der modulare Lernpfad begleitet Absolvent:innen und Wissenschaftler:innen durch sieben Stationen – von der ersten Inspiration über das Geschäftsmodell bis zum Pitch. Aber auch wer nie gründen will, profitiert: Die Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit und Tragfähigkeit vermittelt Future Skills, die überall gefragt sind.

Science2Startup
Von der Forschung ins eigene Business? Lerne im interaktiven Lernprogramm, wie du deine (wissenschaftlichen) Erkenntnisse in unternehmerischen Erfolg umsetzen kannst.
1 – Der Mehrwert entscheidet
Und jetzt zur großen Frage: Was macht hybride Lehre eigentlich aus? Ellen Pflaum, Teamleiterin der HOOU an der HAW Hamburg, hat eine klare Antwort. Sie lautet: Es gibt viele richtige Antworten. Jede Hochschule findet ihren eigenen Mix aus Digital und Präsenz. Entscheidend ist nicht die Form, sondern der Nutzen für die Studierenden.
Ihr Bild von hybrider Lehre? Ein offenes Haus mit Türen, Fenstern und Treppen überall. Bunt, weil es verschiedene Disziplinen und Perspektiven vereint. Und solide, weil es auf wissenschaftlicher Erfahrung und jahrzehntelanger Lehrpraxis aufbaut.
Das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis dieser Broschüre: Hybride Lehre und OER sind keine Frage der perfekten Methode. Sie sind eine Einladung, Bildung gemeinsam weiterzudenken.
Die ganze Broschüre lesen?
Alle zehn Gedanken, die Projektberichte, Interviews und Checklisten gibt’s hier zum kostenlosen Download – als OER unter CC BY 4.0.

Bild: Paula O. Guglielmi
22.01.2026 | hoouadmin
Eine Stimme für alle: Wie das Klimaparlament Wesen und Unwesen in den Blick nimmt
Das Projekt „Klimaparlament sämtlicher Wesen und Unwesen“ der TU Hamburg bringt lebendige Wesen wie Pflanzen, Tiere, Pilze – aber auch „Unwesen“ wie Autos, Steine oder Hochhäuser – symbolisch auf eine Versammlungsebene. Was als theatrales, experimentelles Forum für künstlerisch-politische Auseinandersetzung mit ökologischen Themen begann, kann nun jeder und jede Zuhause nachspielen – und mit den Ergebnissen echte Impulse für Politik oder Nachbarschaft zu setzen. Initiiert wird es von den Künstler-Kollektiven metagarten & helfersyndrom aus Hamburg und Offenbach. Ein Beitrag von Gerd Schild.
Die Menschen machen nur etwa 0,01 Prozent aller Lebewesen auf der Erde aus. Und trotzdem entscheiden sie über die Zukunft des ganzen Planeten. Mit welchem Recht bestimmen wir Menschen über die Erde? Was gibt uns die Macht, unsere Umwelt so zu verändern, dass manche Forschende sogar ein neues geologisches Zeitalter, das Anthropozän, also das Zeitalter des Menschen, ausgerufen haben?
Sicher ist: Wir sind nicht allein. Und was die „Anderen“ denken, fühlen und brauchen, das will ein besonderes Projekt sicht- und hörbar machen. Das „Klimaparlament sämtlicher Wesen und Unwesen“ hat zum Ziel, spielerisch Tieren, Pflanzen und nicht lebenden Dingen eine Stimme zu geben und so andere Perspektiven in die Diskussion einzubringen.
Ungewöhnliche Perspektiven einnehmen
Was wäre also, wenn alle Wesen der Erde, vom Regenwurm über das Eichhörnchen bis zum Stadtbaum, vom Fluss über den Delfin bis zum Blauwal, mitentscheiden könnten über die Zukunft der Erde? Und was hätten „Unwesen” wie Hochhäuser, Autos oder Kohlekraftwerke zu sagen?
Das Projekt „Klimaparlament“ nimmt diese ungewöhnlichen Perspektiven ein und schafft so Raum für einen neuen Diskurs, abseits der oft festgefahrenen Streitlinien. Die zwei Künstler:innen-Kollektive metagarten & helfersyndrom erforschen, welche Konflikte und Ideen dabei zutage treten, wer sich diametral gegenübersteht – und wer vielleicht ungeahnte Koalitionen bilden könnte. Ein Kunstprojekt, hochpolitisch, lustig, verspielt und doch ernst, für die Kleinen wie für die Großen. „Wir wollen mit dem Klimaparlament Gerechtigkeit schaffen und zeigen: Klimadebatten können sogar Spaß machen“, sagt Steffen Lars Popp.

Die Botschafter:innen haben sich umfassend mit den Bedürfnissen ihrer Gruppen auseinandergesetzt und versucht, sich in sie hineinzufühlen.
Amelie Hensel, Theatermacherin
Schon vor fünf Jahren tagte das erste Klimaparlament aller Wesen und Unwesen. Mitten in der Pandemie, im November 2020, konnten sich Interessierte in die Gründungsversammlung online einwählen, während das Team auf Kampnagel, per Livestream mit der Welt verbunden, auf der Bühne war. 36 Botschafterinnen und Botschafter organischer und anorganischer Wesen wirkten an dem Kunstprojekt mit.
Frei nach einer Idee des Philosophen Bruno Latour („Das Parlament der Dinge“) konnten sie in kurzen Vorträgen ihre Argumente und Forderungen vorbringen. Dabei drangen die Moose auf eine bessere Wasserqualität, während die Elbe gegen ihre Vertiefung vorging und der ÖPNV für eine Citymaut für Autos plädierte, die Zoogiraffen wünschten sich eine Savanne im Umland und das Atomkraftwerk in Brokdorf wollte lieber explodieren, als still vom Netz zu gehen. Die kleinen und großen Tiere und Pflanzen und die unorganischen Dinge traten für sich ein, ein Agendasetting, das sonst den Menschen, beziehungsweise den Menschen mit Lobbykraft, vorbehalten ist.
„Die Botschafter:innen haben sich umfassend mit den Bedürfnissen ihrer Gruppen auseinandergesetzt und versucht, sich in sie hineinzufühlen“, sagte Theatermacherin Amelie Hensel bei der Auftaktveranstaltung. „Wir haben durch die enge Zusammenarbeit sehr junge und alte Menschen aus verschiedensten Zusammenhängen, die sehr unterschiedliche Herangehensweisen an die Recherche hatten, kennengelernt und durften miterleben, wie das Wesen oder Unwesen deren Alltagsleben geprägt hat und somit auch unseres.“
Die Menschen dahinter
Das Kernteam des Klimaparlaments besteht aus fünf Personen. Konzipiert von Amelie Hensel und Steffen Lars Popp übernehmen heute alle alles, doch mit Schwerpunkten: Die Bühnen- und Kostümbildnerin Amelie Hensel moderierte im Mooskostüm bei den öffentlichen Debatten die verschiedenen Perspektiven auf der Bühne.
Gemeinsam mit Annette Haunschild, Bühnenbildnerin und Kunstvermittlerin, hat sie die Bühnengestaltung sowie Kostüme der Wesen und Unwesen besonders im Blick. Steffen Lars Popp ist als Theatermacher, Autor und Dramaturg das „Versammlungsleittier“ des Klimaparlaments. Judith Henning ist auch mit für die Texte zuständig, unterstützt als Präsentationslibelle die Versammlung visuell und hilft Botschafter:innen beim Schreiben von Appellen.
Für die Musik und den Sound, die Geräusche der Wesen und Unwesen ist Christoph Rothmeier verantwortlich – als PARR-Referent. PARR steht für psychoakustische Repräsentationsresonanz. Es gibt akustische Visitenkarten, Mini-Hymnen oder ganz bestimmte Geräusche, mit denen die Botschafter:innen die Besonderheit eines Un:wesens auf die Bühne bringen.
Sie verschaffen sich Gehör, ohne Worte, und stoßen so die Synapsen der Hörer:innen ohne Umwege an. „Es entsteht so etwas wie ein schwingender Raum an Aufmerksamkeit zwischen Un:Wesen, Botschaftern und Publikum. Das ist wichtig, und Sound kann das“, sagt Christoph Rothmeier.
Mehr philosophieren
Das Klimaparlament hat sich seit dem Auftakt auf Kampnagel im November 2020 weiterentwickelt. Mehrfach hat das Team eine ständige Vertretung eingerichtet, war mit den Wesen und Unwesen im Museum Sinclair-Haus und im Grünen Hörsaal des Senckenberg-Museums, auf der Biennale in Thessaloniki genauso wie im Berufsbildungszentrum Bad Segeberg.
Und bald wird das Team mit Prof. Dr. Maximilian Kiener zusammenarbeiten. Der ist Leiter des Instituts für Ethik in der Technologie an der TUHH, mit einem Schwerpunkt auf Moral- und Rechtsphilosophie mit einem besonderen Fokus auf Verantwortung. „Wir wünschen uns, dass die Praxis der Spielens zusätzlich Anstoß gibt zum gemeinsamen Philosophieren“, sagt Amelie Hensel. Erste Treffen mit Kiener und seinem Team gab es schon. Besonders spannend ist für ihn der Gedanke des Kontraktualismus, bei dem es um das Aushandeln verschiedener Positionen geht. Hier bringen die Wesen und Unwesen mit ihrer Unterschiedlichkeit unerwartete und extreme Blickwinkel in die Diskussion.
Aus dem Projekt auf der Theaterbühne ist ein Mitmach-Spiel geworden
Mit „Klimaparlament goes Places“ geht das Projekt gleichzeitig noch einen weiteren Schritt. Das Team will die Idee, die Materialien und die Regeln offen zur Verfügung stellen, damit in Workshops oder bei privaten Treffen Spielteams unabhängig von den Initiator:innen ihr eigenes „Klimaparlament der Wesen und Unwesen“ gründen können. „Wir orientieren uns dabei an Rollenspielen wie Dungeons & Dragons oder einem Krimi-Dinner“, sagt Judith Henning. Was sie damit meint: Auch bei solchen Mitmachrunden gibt es oft eine Spielleitung, die Gäste einlädt, und gemeinsam entwickelt man in kurzer Zeit spielerisch ein Thema und setzt es mit Spaß und Mut zur Improvisation direkt um.

Klimawende erspielen: Ein Parlament sämtlicher Un:Wesen
Klima, Wandel, Artensterben – war da was? Mit welchem Recht bestimmen wir über die Erde, obwohl die Menschheit nur 0,01% aller Lebewesen ausmacht? Wenn sämtliche Wesenheiten – Stadtbäume, Eichhörnchen, Flüsse; aber auch “Unwesen” wie Hochhäuser, Autos, Kohlekraftwerke – ihre Stimme in einem Klimaparlament erheben: Welche Konflikte und Ideen offenbaren sich? Und wird sich eine Mehrheit für die Erde zusammenraufen? Jede:r kann einen kurzen Appell beisteuern und als Botschafter:in im Klimaparlament sämtlicher Wesen und Unwesen sprechen. Hier lernst du, wie es funktioniert und du ein Klimaparlament im Großen wie Kleinen gründen kannst. Nutze unsere Spielregeln und Materialien, fasse Beschlüsse und setze sie selbst oder mit deinem Team um! Ihr habt Blut geleckt, seid also erneut hier, um ein weiteres Spiel zu wagen, das noch mehr in die Tiefe geht? Hier geht es zu den → Erweiterungen für die Parlamentsphase
Das Prinzip ist einfach, das Ziel: die Klimawende erspielen. Mit mindestens drei Mitspielenden kann man ein Klimaparlament gründen und dabei in die Haut ganz anderer Wesen oder Unwesen schlüpfen und ist angehalten, Politik für wirklich alle machen. Die Auswahlmöglichkeiten sind nahezu unendlich: Wesen sind sämtliche lebendigen Erdbewohner, also Tiere oder Pflanzen, aber auch Pilze und winzige Mikroben oder Viren (auch wenn deren Lebendigkeit umstritten ist). Unwesen sind anorganisch, können aber trotzdem wirkmächtig sein, wie die Elbe oder der Öffentliche Nahverkehr.
Politische Impulse, die gut für alle sein
Ist das Team gefunden, brauchen die Wesen und Unwesen ein Kostüm, einen passenden Sound und eine kleine Rede, zwei Minuten reichen, die dann in einer Parlamentssitzung gehalten und diskutiert wird. Alle Mitspielenden schlüpfen in ihre Rolle, überlegen, was für die Blaualgen oder den Plastikmüll wichtig sein könnte, wie sie in ihrer Rolle auf die anderen Wesen und Unwesen schauen, auch auf die Menschen – und was sie brauchen, um ein erfülltes Leben auf Erden zu leben.
Am Ende steht im besten Fall ein Beschlusspaket: Politische Impulse, die gut für alle sind. Die kann man filmen oder aufschreiben. Und dann? Können die Beschlüsse an die sogenannte „echte“, also die menschliche Politik geschickt oder persönlich überbracht werden – damit der Blick der Verantwortlichen im Land sich weitet. „Die Spielenden können ihre Ideen natürlich auch gleich umsetzen, eine Streuobstwiese anlegen oder Müll sammeln gehen“, sagt Annette Haunschild.
Interesse an einem eigenen Klimaparlament der Wesen und Unwesen? Das Material und die Spielanleitung zum Klimaparlament gibt es hier.

Bild: Artem Labunsky
15.01.2026 | hoouadmin
Gegen die Vermüllung unserer Städte: Wie kleine Gruppen Großes bewegen
Ein lauer Sommerabend im Park. Überall sitzen Menschen auf Decken, lachen, essen, genießen die Sonne. Stunden später ist niemand mehr da, aber leer ist der Rasen nicht. Überall liegen Dosen, Plastikverpackungen, Zigarettenstummel. Am nächsten Tag passiert es genauso wieder. Was banal klingt, ist ein soziales Phänomen: Vermüllung ist ansteckend. Hier setzt das Lernangebot „Agents of Change“ der Technischen Universität Hamburg an. Es zeigt, wie sich Normen verändern und kleine Gruppen eine große Wirkung entfalten können. Ein Beitrag von Atessa Bucalovic.
Viele von uns orientieren sich daran, was andere tun. Wenn der Platz sauber ist, geben wir uns Mühe, ihn so zu hinterlassen. Wenn er verschmutzt ist, sinkt die Hemmschwelle. Forschende nennen das gesellschaftliche Normen. Das sind unausgesprochene Regeln, die unser Verhalten beeinflussen.
Die Philosophin Cristina Bicchieri erforscht, wie Menschen Verhaltensentscheidungen treffen. Sie beschreibt das so: Menschen folgen Normen, wenn sie glauben, dass andere sie befolgen – und erwarten, dass sie es selbst auch tun.
Mit anderen Worten: Wir halten uns an Regeln, wenn wir glauben, dass sie gelten. Und wenn genug Menschen sich daran halten, entsteht eine neue Normalität.
Das „Agents of Change“ Simulations-Labor
Im „Agents of Change“-Labor der HOOU kannst du selbst erleben, wie soziale Dynamiken entstehen. In der interaktiven Computersimulation begleitest du Spaziergänger:innen im Park und beobachtest, ab wann nachhaltiges Verhalten ins Positive „kippt“, also zur Norm wird. Darin kannst du Einstellungen verändern, um dann zu beobachten, welche Auswirkungen das auf das Verhalten der Personen in der Simulationswelt hat.
- Wie viele Menschen braucht es, damit andere sich anschließen?
- Wie stark wirken Vorbilder, Hinweise oder kleine Anstöße, sogenannte „Nudges“?
- Und was passiert, wenn die „Agents of Change“ konsequent vorangehen?
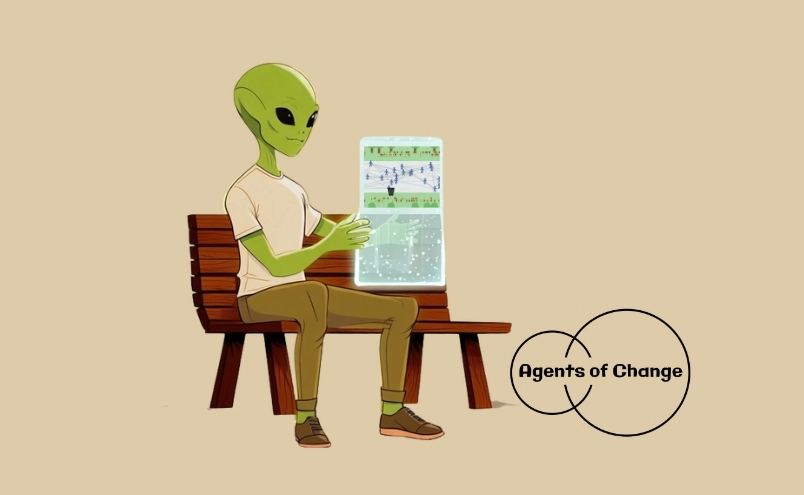
Agents of Change - nachhaltiges Handeln ins Rollen bringen
Unser alltägliches Handeln wird oft von dem Verhalten unserer Mitmenschen beeinflusst. Doch wie viele Personen braucht es, um uns selbst und andere zu nachhaltigem Handeln zu motivieren – zum Beispiel, um unsere Umgebung sauber zu halten? Schlüpf hinein in die Rolle des Beobachter-Aliens „Observer“ und beobachte das Wegwerfverhalten von Menschen mit Hilfe eines Simulations-Labors. Kannst du das Wissen übertragen, um nachhaltiges Handeln in deinem Umfeld ins Rollen zu bringen?
Das Experiment zeigt: Schon eine kleine Gruppe von „Agents of Change“ kann eine große Veränderung anstoßen. Besonders, wenn ihr Verhalten sichtbar, konsequent und glaubwürdig ist. Sie sind die Auslöser dafür, dass aus individuellen Handlungen kollektives Verhalten entsteht.
Was Städte gegen Littering tun – und was wirklich wirkt
Eine Langzeitstudie der Humboldt-Universität Berlin untersuchte in mehreren Großstädten, warum Menschen Müll liegen lassen und welche Maßnahmen helfen. Das Ergebnis: Nicht fehlende Mülleimer sind das Problem, sondern Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit. Besonders betroffen sind Orte, an denen bereits Müll liegt – die sogenannten Littering-Hotspots.
Die Studie zeigte auch, welche Maßnahmen funktionieren:
- Auffällige Mülleimer mit klaren Hinweisen
- Nudges: etwa Fußspuren, die zum nächsten Papierkorb führen
- Plakataktionen mit positiven Botschaften
- Kümmerer:innen oder Waste-Watcher, die im Viertel präsent sind
In Hamburg sind die Waste-Watcher seit Jahren im Einsatz. Sie sprechen Menschen direkt an, sensibilisieren für sauberes Verhalten und stärken so die soziale Norm vor Ort.
Ein Blick nach Hamburg – und in den Müll
Laut dem Bericht „Daten und Fakten 2023“ der Stadtreinigung Hamburg werden jährlich rund 18.500 Tonnen Kehricht, wie zum Beispiel aufgesammelter Straßenmüll, entsorgt. Über 20.000 Papierkörbe stehen in der Stadt und werden bis zu 3 Mal pro Woche geleert.
Diese Zahlen zeigen: Sauberkeit ist eine Mammutaufgabe. An Mülleimern mangelt es nicht, und doch landet viel Abfall auf der Straße. Auch wenn wir nicht genau wissen, wie hoch der Anteil des „fallengelassenen Mülls“ ist, eines ist klar: Jede:r kann dazu beitragen, dass weniger davon im Kehricht landet, indem man den eigenen Müll in den Eimer statt daneben wirft.
Denn Vermüllung beeinflusst nicht nur das Wohlbefinden vieler Menschen, sondern auch das von Tieren, die Abfälle fressen oder sich daran verletzen. Sauberkeit bleibt also eine gemeinsame Aufgabe. Und sie beginnt im Kleinen, bei jeder einzelnen Entscheidung.
Wenn die Szene selbst putzt
Auch in Hannover gibt es ein bemerkenswertes Beispiel für gemeinschaftliches Engagement. Dort treffen sich Menschen aus der Drogenszene regelmäßig, um den Platz vor dem Stellwerk – einer zentralen Anlaufstelle für Suchtkranke – zu reinigen. Das Projekt nennt sich „Die Szene putzt“.
Was als Aufräumaktion begann, ist heute ein Symbol: Verantwortung übernehmen funktioniert, indem man selbst Teil der Lösung wird. So zeigen die Teilnehmenden, dass Mitgestaltung und Würde auch unter schwierigen Lebensbedingungen möglich sind.
Veränderung ist kein Zufall, sondern beeinflussbar
Das alles zeigt: Soziale Veränderung beginnt nicht mit Druck, sondern mit Einsicht. Und mit ein paar Menschen, die anfangen. Die Forschung nennt sie „kritische Masse“: Eine kleine, sichtbare Gruppe, die durch ihr Verhalten andere ansteckt.
Das HOOU-Projekt „Agents of Change“ macht diesen Effekt erlebbar und verbindet so Wissenschaft, Bildung und Gesellschaft. Wer teilnimmt, lernt: Veränderung ist kein Zufall, sondern beeinflussbar. Vor allem, wenn man versteht, wie Normen aktiviert werden können.
Mut zu mehr Verantwortung und damit Veränderung
Sauberkeit ist Teamarbeit und Erwartungsarbeit. Wenn wir zeigen, dass uns der öffentliche Raum wichtig ist, schließen sich andere an.
Das digitale Lernangebot der HOOU macht Mut, Verantwortung zu übernehmen und Veränderung selbst anzustoßen – im eigenen Viertel, auf dem Campus oder im Park.
Denn manchmal braucht es nur ein paar Menschen, die aufstehen, um den Unterschied zu machen.

Bild: Duncan Kidd / Unsplash
11.12.2025 | hoouadmin
Wie Kniffelix die Wissenschaft erlebbar macht
Die KinderForscher an der TU Hamburg wurden 2015 als eines der ersten Projekte der Hamburg Open Online University gefördert. Entstanden ist das digitale Lernangebot Kniffelix, in dem Interessierte mit Alltagsgegenständen selbst Experimente durchführen können. Ein Interview mit der Projektverantwortlichen Gesine Liese von Stephan Dublasky.
Es geht bei dem Gespräch nicht nur um das Lernangebote an sich. Es ist auch ein Rückblick auf die vergangenen zehn Jahr, die Gesine Liese schon mit den KinderForschern an der TU Hamburg aktiv ist und was sich verändert hat.
Wie startete das digitale Angebot der KinderForscher?
Gesine Liese: Wir haben in der Metropolregion Hamburg ein haptisches Projekt aufgebaut mit Experimentierkisten, die mit Alltagsprodukten bestückt sind: Hefe, Ketchup oder Legosteine aus dem Kinderzimmer. Und aus diesen haben wir Experimente entwickelt, zu denen passend die Experimentierkisten ausgeliehen werden können. Und dann hatte ich gehört, dass Professor Sönke Knutzen hier an der Technischen Universität Hamburg, wo ich ja KinderForscher gegründet habe, gerade dabei war, die HOOU aufzubauen, und Projekte suchte, um Wissenschaft an die Gesellschaft zu bringen. Und da habe ich gesagt: Ach, wie klasse ist das denn? Wie können wir das digital in die ganze Welt bringen, dass jeder so lernen kann, wie man das hier in Hamburg kann?
Und dann gab es die ersten Experimente zu Fragen wie: Wie geht Hefe auf und warum kommt der Ketchup nicht aus der Flasche? Also zu sehr alltagsnahen Themen. Das heißt, man brauchte dann, wenn man das machen wollte, nicht die Experimentierkiste, sondern man konnte es mit Alltagsgegenständen aus der eigenen Küche machen. Und wir haben es auch zugleich so konzipiert, dass jede Lehrkraft, egal wo sie auf der Welt ist, von zu Hause oder in der Schule, diese Sachen zusammensuchen und auch mit der Klasse experimentieren kann.
Bei euch geht es nicht nur um das Verstehen. Man muss auch mitmachen?
Liese: Man kann mitmachen. Lernen ist ja immer ein Angebot, aber man kann alle Sinne einsetzen. Also bei Kniffelix kann man nicht nur Fernsehen gucken wie bei der Sendung mit der Maus. Es ist auch so ein bisschen die Vorbildidee dahinter, da sitzt man aber passiv und guckt. Und ich wollte dieses Erlebnis viel größer machen. Ich wollte, dass man ausprobieren kann, wirklich mit den Händen arbeiten in der Küche, am Schreibtisch, am Esszimmertisch, im Garten. Dass man Sachen ausprobieren kann, die man digital gesehen hat – in Videos, Texten, Downloads und Arbeitsblättern.
Beim Lesen des Textes lerne ich schon etwas, aber wenn ich dann noch Wörter einfüllen muss? Zwischendurch macht mich das viel aktiver, als wenn ich nur lese. Und ich kann auch überprüfen, habe ich das verstanden, was ich da gerade gesehen oder erlebt habe. Und das Tolle am digitalen Lernen, also in der Hamburg Open Online University, ist, wenn ich jetzt gerade was nicht verstanden habe und es mich interessiert, kann ich jederzeit zurückgehen. Ich kann es an mein eigenes Tempo, an mein eigenes Lernverständnis anpassen.
Kniffelix ist durch die HOOU mehrere Jahre gefördert worden. Welche Angebote habt ihr realisiert in der Zeit?
Liese: Wir haben sechs Grundthemen erschaffen, sodass jede:r ab acht Jahren bis 99 die beliebtesten KinderForscher-Themen erleben konnte. Ich bin auch immer wieder angesprochen worden von Erwachsenen, die verstehen ja auch nicht immer, was die Hefe im Pizza- oder Brotteig zum Gehen bringt. Ich weiß auch nicht, warum der Ketchup schnell oder langsam ist. Das ist für einen Achtjährigen total interessant, aber genauso war meine Schwiegermutter ganz begeistert mit über 80 Jahren. Die beliebtesten Fragen haben wir im KinderForscher-Team digital umgesetzt: Hefe, Ketchup, dann das Thema Flugzeug mit der Frage: Wie müssen Tragflächen geformt werden? Dann unser viertes Thema: Wo muss der Schwerpunkt im Flugzeug liegen? Danach ging es um die Produktentwicklung: Wie kommt man von der Idee eines Hubschraubers dazu, dass man einen Hubschrauber entweder als reales Produkt oder als Spielzeug entwickelt? Dann haben wir noch das Thema Boden oder Erde gemacht. Wenn ich eine Topfpflanze ziehe, woher soll ich wissen, was für eine Erde ich nehmen soll, wenn ich in den Baumarkt gehe? Da gibt es Säcke mit Zitronen-, Rhododendron-, Rosen- oder einfach Pflanzenerde. Was ist eigentlich Erde und worin unterscheidet sie sich? Dann stirbt die Topfpflanze auch nicht so schnell, sondern wächst und gedeiht, und man weiß sogar warum!

Kniffelix
Entdecke unseren Mitmach-Experimentier-Blog und lerne anhand von Forschungsmissionen mehr über alltägliche Situationen.
Wie ist es mit Kniffelix nach der Förderung durch die HOOU weitergegangen?
Liese: Das Entscheidende war, als ich in der Hamburg Open Online University diese Förderung bekommen habe, dass ich von vornherein wusste, ich würde immer wieder rausgehen und weiteres Fördergeld von anderen Stellen nutzen, um auf dieses Fundament, das mir die HOOU ermöglicht hat, neue Projekte draufzusetzen und es wirklich als die digitale Kommunikationsplattform zu nutzen, die es heutzutage ist.
Wir haben im Rahmen des Ralf Dahrendorf Preises vom BMBF Gelder bekommen, sodass ich zusammen mit den Mitarbeitenden von Professorin Irina Smirnova vom Institut für Thermische Verfahrenstechnik der TU Hamburg konnte ein Thema aufgebaut werden. Aerogele sind die leichtesten Feststoffe der Welt und man kann zum Beispiel nachhaltige Baumaterialien ganz interessant mit Aerogelen herstellen. Man kann aber auch den leichtesten Nachttisch der Welt machen: aerogeles Gebäck oder eine aerogele Erdbeere – eine Erdbeere, die man anschließend auch essen kann. Also ein total cooles Thema!
Dann habe ich einen Antrag an die Sigma Aldrich Foundation in den USA geschrieben (durch Empfehlung von Merck in Deutschland) und gesagt, dass ich gerne mehr Themen entwickeln möchte, sodass wir weltweit mehr Schülerinnen erreichen können. Damit habe ich eine neue Mitarbeiterin eingestellt, die dann das Thema Chromatografie umgesetzt hat. Dabei geht es um Trennverfahren. Jeder kennt es schon als Kind: man malt ein Bild mit Filzstiften und dann trinkt man etwas oder isst ein Eis dabei, und dann klecksen Tropfen aufs Papier. Plötzlich sieht man, dass zum Beispiel der rote Filzstift in dem Tropfen Wasser aufgetrennt wird in Gelb und Pink, weil Rot durch Magenta und Gelb hergestellt wird. Das ist Chromatografie, und wer mehr darüber lernen will, kann das auf Kniffelix lernen. Es geht auch darum, wie Forschende das in ihrer Forschung nutzen. Bis heute fördert Merck die weitere Entwicklung neuer Kniffelix-Themen und die KinderForscher.
Welche Themen sind für die Zukunft geplant?
Liese: Dr. Paul Bubckenheim vom Institut für Technische Biokatalyse der TU Hamburg hat zusammen mit dem Start-up Infinite Roots einen erfolgreichen Projektantrag beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gestellt. Wir suchen gerade eine neue Mitarbeiterin mit einer 60-Prozent-Stelle für drei Jahre, um das neue Thema zu entwickeln. Es geht darum, die Molke als Hauptnebenprodukt der Milchverarbeitung aufzuwerten und für die Herstellung neuer Lebensmittel und neuer Produkte zu nutzen, zum Beispiel um Pilz-Mycelium zu züchten.
Wir werden genau bei den Pilzen anfangen, bei etwas, das alle in ihrem Alltag kennen. Wir werden die Forschung begleiten und auch darstellen, wofür Pilze und ihr Mycelium bisher verwendet werden können. Man sieht Pilze im Wald, die an Bäumen wachsen, die in der Erde wachsen. Pilze haben eine enorme Bedeutung für das komplette Ökosystem, also nicht nur für unser Angebot an Nahrungsmitteln – das werden alle bei Kniffelix lernen können.
Was würdest du neuen HOOU-Projekten raten, die jetzt eine Förderung beantragen?
Liese: Wie sollte man sich ein Projekt ausdenken und loslaufen? Das ganz Entscheidende beim Lernen ist: Worauf habe ich Lust, worauf habe ich Bock, wofür brenne ich? Und wenn man da etwas findet… und mein großes Ziel war, meine Leidenschaft in die Welt hinauszutragen. Das Allerwichtigste ist, dass man sich einfach fragt: Woran arbeite ich gerne? Man muss den Mut haben, einen Antrag zu stellen und das innere Selbstvertrauen, dass da schon etwas Cooles herauskommen wird.
Über Giese Liese

Gesine Liese wuchs unter anderem im Silicon Valley auf und ist eine überzeugte Gründerin, die aus der sprichwörtlichen Garage heraus startete. Im Jahr 2007 entwickelte sie zusammen mit ihrem Mann, Professor Andreas Liese, Leiter des Instituts für Technische Biokatalyse, die Nachwuchsinitiative KinderForscher an der TU Hamburg. Zunächst begann alles in der heimischen Küche, danach auf dem Campus der TU Hamburg.

Bild: Antonio Janeski
28.11.2025 | Meena Stavesand
Hochschulbildung für alle – aber wie? 5 Learnings aus der Praxis
Wie erreicht man Menschen, die nicht an der Uni sind, mit wissenschaftlichen Inhalten? Die Antwort auf diese Frage ist nicht einfach. Seit 10 Jahren engagiert sich die Hamburg Open Online University in diesem Bereich und hat schon viel dazugelernt. Das Team der TU Hamburg gibt nun 5 Learnings dazu. Es geht um die gesellschaftliche Relevanz von Themen, um das Überwinden digitaler Barrieren und um Öffentlichkeitsarbeit. Ein Text von Katrin Bock.
Hochschulen nehmen als Orte der Wissensvermittlung, der Erkenntnisbildung und der Reflexion eine wichtige gesellschaftliche Rolle ein. Es ist jedoch nicht einfach, diese Prozesse für alle sichtbar und zugänglich zu machen. Gesellschaftliche Teilhabe an der Hochschulbildung wird durch viele Barrieren erschwert. Um diese zu überwinden, setzt die HOOU auf die Bereitstellung digitaler Lernangebote auf einer offenen und freien Lernplattform. Die interessierte Öffentlichkeit soll so, gebündelt an einem ansprechenden digitalen Ort, Zugang zu vielfältigen Inhalten aus Forschung und Lehre an den Hochschulen erhalten.
Doch die interessierte Öffentlichkeit ist divers. Lernende bringen unterschiedliche Kompetenzen und Kenntnisse mit, kommen aus verschiedensten Kontexten, haben unterschiedliche Motivationen und lernen auf ganz unterschiedliche Weise. Das Team der HOOU@TU Hamburg versucht, dies bei der Entwicklung digitaler Lernangebote zu berücksichtigen, und möchte möglichst vielen Menschen Zugang zu ihren Inhalten ermöglichen. So konnte das Team aus den vergangenen zehn Jahren Lernangebotsentwicklung einige Learnings mitnehmen:
1. Gesellschaftliche Relevanz als inhaltlicher Ausgangspunkt für wissenschaftliche Themen kann Barrieren überwinden
Um Verständnisbarrieren bei wissenschaftlichen und abstrakten Themen zu überwinden, kann die gesellschaftliche Relevanz als niedrigschwelliger Einstieg Zugänge ermöglichen. Denn zu lernen, warum ein Sachverhalt wichtig ist und was dieser mit der eigenen Lebenswelt zu tun hat, fördert die Motivation und Fähigkeit, diesen zu verstehen.
Dabei können auch mentale Hürden, die entstehen können, wenn wissenschaftliche Inhalte durch ihre Komplexität als nicht passend wahrgenommen werden, verkleinert werden.
2. Kleine, leicht verständliche Wissenshäppchen für einen niedrigschwelligen Einstieg ins Lernen
Neben den eher umfangreicheren Lernangeboten, in denen sich die Lernenden intensiv mit verschiedenen Themen beschäftigen, setzt die HOOU an der TU Hamburg auch auf das Format „Wissenschaft kurz erklärt“. In kleinen Informationsangeboten werden Inhalte leicht verständlich aufbereitet und ermöglichen so einen ansprechenden und vor allem schnellen Zugang zu Wissen.
Diese Angebote lassen sich in sehr kurzer Zeit durcharbeiten. Dafür werden verschiedene Medien eingesetzt. Mit kurzen Videos und Podcasts oder interaktiven Grafiken werden die Inhalte auf verschiedene Weise vermittelt. Wer dann doch tiefer in die jeweiligen Themen einsteigen möchte, erhält Vorschläge für passende umfangreichere Lernangebote.

Was bedeutet “Bildung für alle“?<br>Grundsätzlich geht es darum, dass alle Menschen einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung erhalten. Dabei sollen allen die gleichen Möglichkeiten offenstehen, selbstbestimmt an qualitativ hochwertiger Bildung teilzuhaben und ihre Potentiale zu entfalten, unabhängig ihrer Voraussetzungen oder bestimmter Bedingungen. Systematische Ungleichheiten oder Benachteiligungen müssen dabei im Sinne der Chancengleichheit verhindert werden (vgl. UNESCO, 2005).
3. Lernangebotsentwicklung nach dem Constructive Alignment zur Lernendenzentrierung
Die Grundlage der Lernangebotsentwicklung der HOOU an der TU Hamburg bilden, angelehnt an das Konzept des Constructive Alignment, die Lernziele (vgl. Biggs &Tang, 2011). Diese sind, unabhängig von technischen Möglichkeiten oder neusten Trends, der Startpunkt für die inhaltliche Gestaltung und Entwicklung der Lehr- und Lernaktivitäten.
Die Angebote werden in einem ersten Schritt rein konzeptionell entwickelt, erst in einem zweiten Schritt werden passende mediendidaktische Formate und technische Tools für die Umsetzung ausgewählt. Eine solche unabhängige Ausrichtung auf die Lernenden kann dabei helfen, Verständnisbarrieren für diese zu überwinden und verhindert ein Überangebot an technischen Tools, welches die Lernenden überfordern kann.
Eine gezielte und bedürfnisorientierte Auswahl der technischen Möglichkeiten unterstützt außerdem die Überwindung digitaler Barrieren, indem eine intuitive und individuell anpassbare Nutzung des Lernangebotes gefördert wird.
4. Experimentierfelder für neue technische Möglichkeiten zur Überwindung digitaler Barrieren
Im Laufe der vergangenen zehn Jahre hat die HOOU an der TU Hamburg im Rahmen von Experimentierfeldern verschiedene technische Möglichkeiten ausprobiert und evaluiert. Eine große Herausforderung war und ist dabei die Berücksichtigung verschiedener Perspektiven. Im Rahmen eines umfangreichen Anforderungsmanagements für die Plattformentwicklung werden diese identifiziert, um technische Anforderungen zu entwickeln und zu priorisieren.
Denn ebenso wie die Technik entwickeln sich auch die Bedarfe der Menschen weiter. Um Barrieren zu überwinden und Zugänge zu schaffen, wird dies immer zusammen gedacht. Dadurch konnten bereits viele Potenziale sowie auch Probleme identifiziert und für die neue Plattform implementiert oder ausgeschlossen werden.
5. Digitale Lernangebote allein schaffen nicht ausreichend Zugänge
Die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren haben eindeutig gezeigt: Eine öffentliche Plattform als alleiniger Zugangspunkt zu digitalen Lernangeboten reicht oft nicht aus, um alle Menschen zu erreichen. Dies liegt vor allem an der Fülle an Informationen, die im Netz zu finden sind, und der Art und Weise, wie Menschen sich dort informieren und lernen.
So ist es wichtig, Lernangebote kontextuell einzubetten, um Zugangsmöglichkeiten zu erweitern. Dies kann eine zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit sein, durch die Lernende beispielsweise über Social Media oder durch Plakate zu Inhalten gelangen. Aber auch Lernerlebnisse in der analogen Welt schaffen Zugänge, indem sie Menschen vor Ort abholen und verbinden. Dies versucht die HOOU an der TU Hamburg über verschiedene Veranstaltungsformate, auch außerhalb der Hochschulen, aber auch durch die Einbindung ihrer Inhalte in die Lehre.
Welche Barrieren kann es für den Zugang zur Hochschulbildung geben?
Die Art der Barrieren, die Menschen beim Zugang zu Hochschulbildung begegnen, sind vielfältig. Hier einige Beispiele, die besonders häufig auftreten:
Informationsbarrieren: Was passiert an unseren Hochschulen in Forschung und Lehre? Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen sind leider nicht immer leicht zu finden. Informationen von Hochschulen verstecken sich oft – wenn sie überhaupt öffentlich zugänglich sind – auf unübersichtlichen Hochschul- oder Projektwebseiten. Inhalte sind nicht selten schlecht gepflegt und veraltet, was das Finden der richtigen Informationen zusätzlich erschwert.
Sprach- und Verständnisbarrieren: Nicht alle können etwas mit wissenschaftlicher Sprache anfangen. Viele Fremdwörter und komplexe Satzstrukturen setzen eine hohe Sprach- und Lesekompetenz voraus und sorgen dafür, dass viele Menschen diese nicht verstehen können oder durch einen erschwerten Lesefluss kein Interesse an akademischen Texten haben. Viele Texte stehen nur in einer Sprache zur Verfügung, sodass Zugänge zusätzlich beschränkt sind.
Digitale Barrieren: Trotz gesetzlicher Vorschriften und Regelungen sind viele Webseiten im Hochschulkontext nicht barrierefrei. Durch fehlende technische Möglichkeiten zur bedürfnisorientierten Gestaltung und einer unzureichenden Usability kann eine intuitive und individuelle Nutzung der Webinhalte nicht gewährleistet werden.
Mentale Barrieren: Hochschulen haben es in Zeiten von Fake News, Nachrichtenmüdigkeit und diversen Krisen nicht leicht, die breite Öffentlichkeit zu erreichen. Vielen Menschen fehlt es an Vertrauen in die Wissenschaft oder sie fühlen sich durch hierarchische Strukturen im Sinne eines „von oben herab“ nicht adressiert.
Der lange Weg zu einem niederschwelligen Zugang
Die Lernangebote der HOOU an der TU Hamburg können also durch eine lernzielorientierte, didaktische Konzeptionierung und den passenden Einsatz technischer Möglichkeiten Zugänge zur Hochschulbildung ermöglichen. In Verbindung mit zielgruppengerechter Öffentlichkeitsarbeit und gemeinsamen Lernerlebnissen in der Öffentlichkeit werden diese Zugänge ausgeweitet.
Durch die offene und ansprechende HOOU Lernplattform, die neben den digitalen Lernangeboten weitere Inhalte zu gesellschaftlich relevanten Themen in verschiedenen Formaten niedrigschwellig zur Verfügung stellt, werden Barrieren überwunden. Trotz dieser Potenziale ist es jedoch noch ein weiter Weg für die HOOU, Hochschulbildung wirklich frei zugänglich für alle Menschen zu machen. Viele Inhalte der HOOU stehen nicht mehrsprachig zur Verfügung und sind thematisch sehr spezifisch.
Die Plattform an sich ist noch nicht komplett barrierefrei, hier gibt es vor allem technisch noch viel Entwicklungsbedarf. Zugänglichkeit ist kein irgendwann abgeschlossener Zustand, sondern ein Prozess, den die HOOU stetig versucht, weiter voranzutreiben. Für die HOOU an der TU Hamburg heißt dies also auch für die nächsten zehn Jahre, mehr Zugänge zu ermöglichen, damit Bildung für alle wirklich irgendwann Bildung für alle ist. Wir freuen uns darauf, unsere Learnings dafür weiter auszubauen!
Literatur
Biggs J. & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University: What the Student Does (4. Aufl.): Maidenhead: Open University Press.
UNESCO (Hrsg.).(2005).Guidelines for inclusion: ensuring access to education for all. Paris: UNESCO.

Unsere Slammer:innen (v.l.): Carsten Westarp, Charlotte Goblirsch, Franz Vergöhl, Mohsen Falah, Rami Olsen, Elena Khurgina, Moderator Ronny Röwert. Bild: Max Glas
12.11.2025 | Meena Stavesand
Wissenschaft erleben: Slammer:innen zeigen Vielfalt der Hochschulen
Mehr als 150 Gäste kamen zum zweiten Science and Art Slam der HOOU. Sie sahen sechs Performances von beeindruckender Bandbreite – vom Bauingenieurwesen über Nachhaltigkeit im E-Commerce bis hin zu klangvollen Auftritten mit Gitarre und Cembalo. Wo gibt es eine solche thematische Vielfalt? An unseren Hamburger Hochschulen!
Wissenschaft? Ach, die Themen sind mir oft viel zu abstrakt! Aktuelle Forschungen? Betreffen mich nicht! So denken viele Menschen. Dabei gibt es sehr viele Erkenntnisse der Hochschulen, die unseren Alltag sogar ziemlich direkt berühren. Unser zweiter Science and Art Slam hat das eindrucksvoll gezeigt. Wissenschaftler:innen sprachen in kurzen Vorträgen über ihre aktuellen Forschungen, die uns alle betreffen.
Es ging um marode Brücken, über die wir täglich fahren, über nachhaltiges Online-Shopping, über besondere Töne und Instrumente, die wir zwar nicht alltäglich hören, die uns aber direkt verzaubern können. Wissenschaftserleben nennen wir das bei der HOOU. Erkenntnisse werden nahbar und (be)greifbar – für alle.
Mohsen Falah begeistert trotz Zeitproblem
„911, what’s your emergency?“ Mit dieser Frage hat Bauingenieur Mohsen Falah von der TU Hamburg die mehr als 150 Besucher:innen in der Zentralbibliothek der Bücherhallen Hamburg überzeugt. Der Doktorand wählte stellvertretend für die vielen brüchigen Brücken in Hamburg den Notruf und kassierte den lautesten Applaus. Damit setzte er sich gegen fünf weitere spannende Performances durch – obwohl er nach den gesetzten 10 Minuten Redezeit eigentlich noch zig Folien vor sich hatte. Sein Auftritt war persönlich, emotional und damit vor allem eins: mitreißend fürs Publikum.

Klänge vergangener Zeit treffen auf E-Commerce
Die Nahbarkeit der Wissenschaftler:innen zeichnete den Slam aus. Denn lauten und langanhaltenden Beifall gab es auch für die anderen Teilnehmenden:
- Charlotte Goblirsch (TU Hamburg) berichtete über ihre Promotion zu mehr Nachhaltigkeit beim Online-Shopping.
- Rami Olsen (Hochschule für Musik und Theater Hamburg) erklärte seine Leidenschaft für die Unendlichkeit und Mikrotonalität und sang gemeinsam mit dem Publikum.
- Franz Vergöhl (HafenCity Universität Hamburg) beschäftigte sich mit nichts Geringerem als der Hochschulreform, die am Ende vielleicht ChatGPT schreibt.
- Carsten Westarp (HAW Hamburg) sprach als Physiker über die Irrungen und Wirrungen in der Lehre.
- Elena Khurgina (Hochschule für Musik und Theater Hamburg) bewies in ihrem Slam, dass das Cembalo nicht nur barocke Töne von sich geben kann.
Diese Mischung zeigt das Motto des Science and Art Slams der HOOU: Hier trifft Wissenschaft auf Kunst und Kultur. Es geht darum, die Vielfalt unserer Hochschulen und ihrer Arbeit zu zeigen. Das ist den Slammer:innen eindrucksvoll gelungen.














Vielen Dank an alle, die in diesem Jahr dabei waren!
Credit: Alle Bilder stammen von Maximilian Glas.