Schlagwort: HOOU@HAW

Bild: Joe Ciciarelli/Unsplash
04.04.2024 | Meena Stavesand
Mit Comics lernen – so setzen wir die bunten Geschichten in der Bildung ein
Jeder kennt sie, die bunten Bilder, die eine Geschichte erzählen. Doch lassen sich Comics auch in der Bildung einsetzen? Die Antwort lautet: ja!
Ein Comic ist ein Medium, das oft unterschätzt wird, wenn es um Bildung und Lernen geht. Wenn wir an Comics denken, kommen uns oft bunte Bilder von Superhelden oder humorvolle Alltagsgeschichten in den Sinn. Aber Comics können so viel mehr sein. Sie sind eine spannende Mischung aus Text und Bild, die in der Lage ist, komplexe Themen auf eine einfache und verständliche Weise zu vermitteln. Und darum eignen sie sich auch hervorragend für Lehr- und Lernmaterialien.
Comics: Eine lebendige Verbindung von Kunst und Wissen
Der Zauber der Comics liegt in ihrer Fähigkeit, Text und Bild harmonisch miteinander zu verschmelzen. Sie schaffen eine visuelle Erzählweise, die den Lernstoff interessant gestaltet und uns (und unsere Aufmerksamkeit) damit fesselt. Durch die Visualisierung von Konzepten und die Darstellung von Handlungen und Emotionen können Comics komplizierte Ideen leicht verständlich machen.
Podcastfolge zu dem Einsatz von Comics in Bildung und Kommunikation
In einer Folge unseres Podcasts „Hamburg hOERt ein HOOU“ spricht Nicola Wessinghage mit Martina Schradi und Véro über das Potenzial von Comics zur Vermittlung von Wissen und zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlich relevanten Themen. Die beiden Expertinnen erklären darin, welche verschiedenen Eigenschaften und Potenziale von Comics besonders geeignet sind, um Menschen zu motivieren, sich mit wissenschaftlichen Themen und Bildungsinhalten auseinanderzusetzen. Es geht auch um die Frage, ob ein Comic ein seriöses Medium ist.

Drei Gründe für Comics als Lehr- und Lernmaterial
- Vielseitige Darstellungsmöglichkeiten: Comics schöpfen aus einem reichen Repertoire an visuellen und erzählerischen Mitteln, um eine breite Palette an Inhalten greifbar zu machen. Seien es physikalische Phänomene, abstrakte Konzepte oder Emotionen, durch die illustrative Kraft der Comics können diese Themen lebendig und zugänglich dargestellt werden. Besonders bei Sachverhalten, die sich schwer in Worte fassen lassen oder auf den ersten Blick eher trocken wirken, können Comics eine spannende und aufschlussreiche Darstellungsform bieten.
- Erzählerische Elemente steigern die Motivation: Die narrative Natur der Comics zieht Leser:innen in den Bann. Durch die Darstellung von Figuren – ob menschlich oder nicht – entsteht eine Identifikationsfläche, die es ermöglicht, die Ereignisse im Comic mit eigenen Erfahrungen in Bezug zu setzen oder zu vergleichen. Die erzählte Geschichte fördert nicht nur das Interesse, sondern ermöglicht auch eine tiefere Auseinandersetzung mit dem dargelegten Thema. Dieser narrative Ansatz verankert das neu erworbene Wissen auf eine persönliche und nachhaltige Weise.
- Universelle Einsatzmöglichkeiten: Die charakteristische Einfachheit des Zeichenstils macht Comics zu einem vielseitigen Lernmedium, das unabhängig von Alter, Geschlecht, kulturellem Hintergrund oder Bildungsniveau verstanden werden kann. Die vereinfachte Darstellung erleichtert die Identifikation mit den Figuren, was wiederum den Lernprozess fördert, insbesondere in heterogenen Zielgruppen. Diese Eigenschaft ist besonders wertvoll im Kontext von Open Educational Resources (OER) und der Bildung für alle.
Gelungene Beispiele für Comics auch in unseren Lernangeboten findest du auf dem Lehre:Digital-Blog der HAW Hamburg. Der Artikel bietet eine schöne Übersicht darüber, wie vielfältig Comics einzusetzen sind und dass es nicht nur lustige oder fröhliche Themen sein müssen, die mit Comics erläutert werden.

Bild: Claudio Schwarz/Unsplash
02.04.2024 | Meena Stavesand
Vielfalt: So gelingt Diversität in den Medien
Es ist Pride Week und gerade derzeit bedienen sich Medien oft stereotyper Darstellungen. Die HAW hat in ihrem neuen Angebot alle Fragen zu einer diversitätssenbilen Mediengestaltung beantwortet. Es geht etwa um Empowerment, Gendern und Barrierefreiheit.
Wir beantworten euch einige wichtige Fragen zu einer diversitätsseniblen Mediengestaltung. Wenn ihr euch damit intensiver beschäftigen möchtet, dann klickt unbedingt unser kostenloses Lernangebot der HAW an.
Alles Wissenswerte über einseitige Blickwinkel, Diskriminierung und Intersektionalität
Die Expert:innen erklären Strategien, um den eigenen, manchmal begrenzten Blickwinkel zu reflektieren, um Diskriminierungsformen wie stereotype Darstellungen in Sprache, Bild und Ton und um Intersektionalität, wo sich etwa mit der Frage beschäftigt wird, warum selten über Morde an Schwarzen Frauen berichtet wird.
Wie kann ich rassismuskritisch fotografieren?
Menschen, die Rassismus erleiden, begegnen in ihrem Leben häufig intensiven Blicken und stehen unter ständiger Beobachtung. Solche Handlungen markieren diese Menschen als auffällig, „anders“ oder „fremd“. Weiße Menschen können hingegen oft unbemerkt bleiben, während sie andere beobachten. Dieser Akt des Beobachtens reflektiert die Vorrechte weißer Menschen, die ebenfalls tief in der Historie der weißen Fotografie und des Reisefilms verwurzelt sind. Diese Medien wurden als Werkzeuge eingesetzt, um Rassismus zu legitimieren und „zu bestätigen“. Fotografie und später der Reisefilm stellten die Hauptmedien dar, um rassistische Erzählungen zu verstärken und zu verbreiten. Die Folgen dieser rassistischen Betrachtungsweisen, Perspektiven und Bildkonstruktionen sind bis heute sehr deutlich in der Darstellung von People of Color und schwarzen Menschen erkennbar. Lies hier, was du dagegen tun kannst.
Sternchen oder Doppelpunkt? Wie gendere ich barrierearm?
Das Thema der geschlechtergerechten Ausdrucksweise ist ein Punkt heftiger Diskussionen. Während einige die Verwendung männlicher Formulierungen kritisieren, weil sie die Vielfalt der Geschlechter verdecken, behaupten andere, dass Texte durch geschlechtergerechte Sprache unleserlich und unverständlich werden. Ein Aspekt, der in der hitzigen Diskussion über geschlechtergerechte Sprache oft verloren geht, sind die Beweggründe für eine geschlechtergerechte Kommunikation. Diese liegen in der Darstellung der Geschlechtervielfalt, dem Wunsch nach Zugehörigkeitsgefühl, etwa in einem bisher männlich dominierten Berufsfeld, einem Club, einem Parlament und so weiter oder in der Thematisierung von Geschlechterdisparitäten. Was es damit auf sich hat, liest du hier.
Wie gestalte ich einen Text oder eine Webseite barrierearm?
Ableistische Sprache bezieht sich auf eine Ausdrucksweise, die Menschen nach bestimmten Fähigkeiten bewertet und sie daher in Kategorien wie „normal“ und „nicht-normal“ einordnet. Bezeichnungen wie „Pflegefall“, „Liliputaner:in“ und „Taubstumme:r“ reduzieren Menschen auf ihre Einschränkungen und sind oft inhaltlich ungenau. Hierbei wird die Beeinträchtigung, unter der die betroffene Person vermeintlich „leidet“, in den Mittelpunkt der Darstellung gestellt. Es wird oft betont, wie jemand „trotz der Beeinträchtigung“ sein Leben bewältigt. Darüber hinaus wird in Diskussionen und Beiträgen über Behinderung und Inklusion oft über Menschen mit Behinderung gesprochen, selten jedoch mit ihnen. Durch diese Art von Diskurs bewerten und beurteilen hauptsächlich nicht betroffene Personen das Leben von Menschen mit Behinderungen und reduzieren es dabei auf deren Einschränkungen. Was das für Barrierefreiheit oder zumindest Barrierearmut bei Texten oder Webseiten bedeutet, erfährst du hier.
Warum ist Empowerment-Journalismus wichtig?
Der Empowerment-Journalismus stellt eine Kritik an der gängigen Praxis dar, bei der Journalist:innen oft marginalisierte Gemeinschaften kurzzeitig besuchen, um deren Erlebnisse für eine breitere Öffentlichkeit oder das heimische Publikum zu interpretieren. Dieses Vorgehen wird oft als Fallschirm-Journalismus bezeichnet. Im Gegensatz dazu zielt der Empowerment-Journalismus darauf ab, die Perspektive umzukehren. Hier ist das primäre Publikum jene Gemeinschaft, über die berichtet wird. Der Fokus liegt auf der Zusammenarbeit mit diesen Gemeinschaften, um Inhalte zu erstellen, die aus ihrer Sicht wirklich bedeutsam sind. Ziel ist es, die Gemeinschaften durch die Berichterstattung zu stärken.
Maya Lefkowich und ihre Kolleg:innen identifizieren vier Grundsätze des Empowerment-Journalismus:
- Verantwortungsübernahme (accountability)
- Gegenseitigkeit (reciprocity)
- Zusammenarbeit (collaboration)
- Community-Fokus (local ownership)
In ihrem Fachartikel präsentieren sie drei Projekte, in denen sie versucht haben, diese Prinzipien umzusetzen. Sie teilen sowohl die Erfolge als auch die Herausforderungen, die sie bei der Umsetzung dieser Prinzipien erlebt haben. Lies hier mehr über Empowerment.
Hast du weitere Fragen zum Thema Diversität in den Medien und der Mediengestaltung? Dann findest du die Antworten garantiert in unserem umfangreichen und komplett kostenlosen Lernangebot der HAW. Klick rein und informiere dich über dieses gesellschaftsrelevante Thema!

Bild: Gerd Altmann auf Pixabay
08.03.2024 | hoouadmin
HAW-Projekt "Cooperate!": So arbeiten wir konstruktiv und kooperativ im Team
In dem Lernangebot "Cooperate!" können die Teilnehmenden lernen, wie sie im Team reflektiert miteinander umgehen. Das Projekt wird Ende 2024 frei zugänglich sein.
Die Arbeitswelt verändert sich stetig und immer schneller. Wie können wir dieser zunehmenden Komplexität und diesen neuen Herausforderungen begegnen? Das Projekt „Cooperate!“ der HAW Hamburg erstellt dazu ein betriebswirtschaftliches Planspiel als Open Educational Resources unter offener Lizenz.
Dabei sollen projektbezogene Kooperationen der Teilnehmenden trainiert und reflektiert werden. Die Teilnehmenden lernen, kooperativ und konstruktiv zu arbeiten sowie reflektiert miteinander umzugehen. Sie verbessern damit ihre Handlungskompetenz in unvertrauten, dynamischen Umgebungen.
Interdisziplinäre und interkulturelle Vielfalt als Bereicherung
In dieser Umgebung können Menschen erlernen, wie mit interdisziplinärer und interkultureller Vielfalt im Team erfolgreich und zielorientiert kooperiert werden kann. Auf der HOOU-Plattform sollen am Ende im Sinne von Train-the-Trainer Materialien in Form von Manuals für die Lernbegleitung erstellt werden. Dabei hat das Projekt die Entwicklung, Dokumentation und Durchführung eines kollaborativen interdisziplinären Lehr- und Lernkonzepts zum Ziel. Ergänzt wird dieses durch ein projektbezogenes Planspiel, das den praktischen Rahmen bildet.
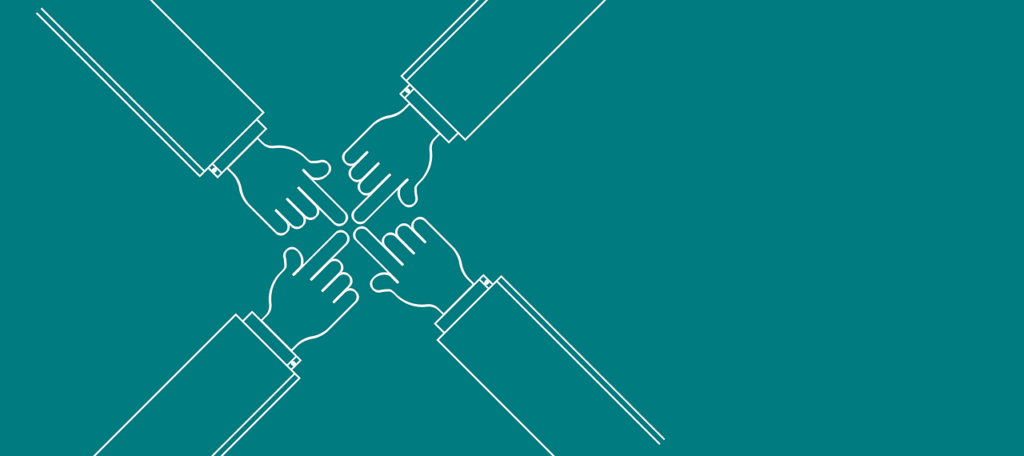
Nach der Bearbeitung des Planspiels sollen die Nutzenden verschiedene Teilkompetenzen verbessern und festigen können:
- Personale Kompetenz: Fremdsprachenpraxis, Flexibilität, Umgang mit Unsicherheit, Verbesserung der Initiativfähigkeit, Rollendistanz
- Soziale Kompetenz: unter anderem Kooperationsfähigkeit, Verbesserung des Empathievermögens in interdisziplinären und interkulturellen Kontexten, Metakommunikation, Synergiebildung in heterogenen Gruppen.
- Methodische Kompetenz: unter anderem Konfliktlösekompetenzen, Zeitmanagement in internationalen Kontexten, Reflexion/Thematisierung der Kulturbedingtheit von Handlungsstrategien usw.
Das Projekt wird im Dezember 2024 von den Verantwortlichen abgeschlossen und auf der HOOU-Plattform frei zugänglich für alle sein.
Text: Dorothee Wagner/HAW Hamburg
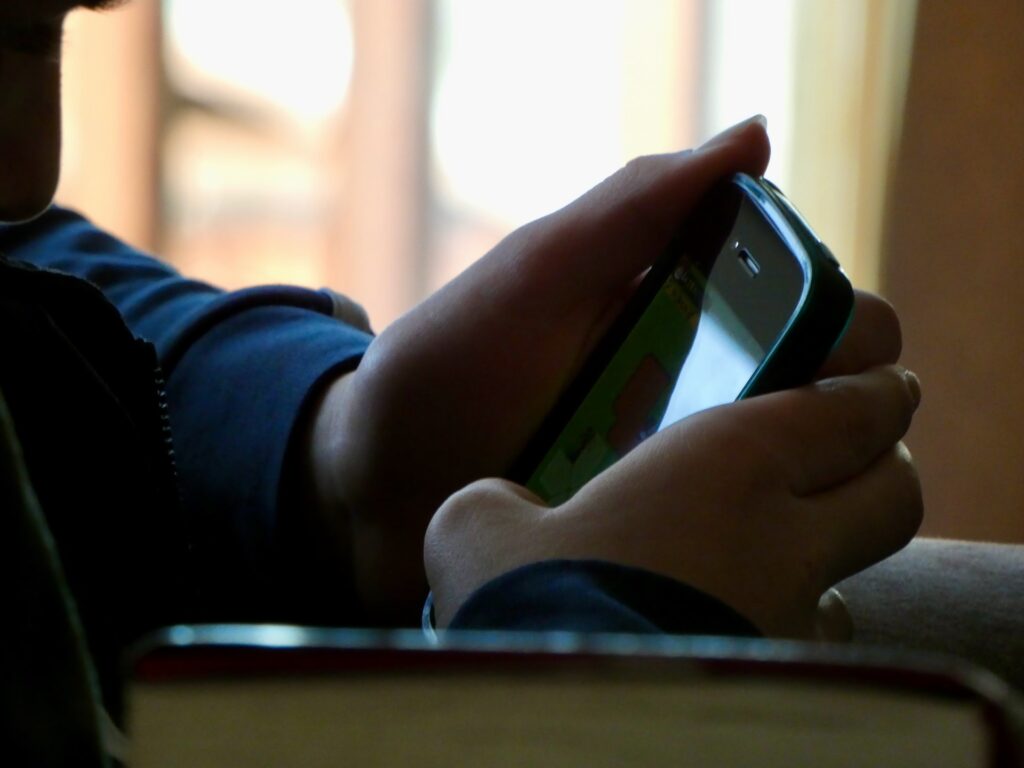
Headerbild: Trenton Stevens/Unsplash
21.12.2023 | Meena Stavesand
Nachrichten für Kinder: So fördern wir die Medienkompetenz
Wie müssen kindgerechte News aussehen? Und wie können wir den jungen Menschen dabei helfen, die Nachrichtenlage richtig einzuschätzen? In diesem Lernangebot gibt es Antworten auf diese und weitere spannende Fragen.
Einmal die Welt mit Kinderaugen sehen – das wünschen sich viele Erwachsene. Denn Kinder gelten als unbeschwert, haben Freude an alltäglichen Dingen, sehen ungetrübt auf die Geschehnisse. Das scheint beneidenswert, lässt aber den Aspekt außer Acht, dass Kinder genauso wie Erwachsene beispielsweise Nachrichten hören und sehen – und damit auch verarbeiten müssen. Sie hören von Krisen und Kriegen, brauchen aber Hilfe dabei, diese zu verstehen und zu reflektieren. Dafür hat die HAW Hamburg das Lernangebot „Nachrichten für Kinder – ein Ratgeber für die Praxis“ erstellt, das sowohl Journalistinnen und Journalisten unterstützen soll, kindgerechte Angebote zu produzieren, also auch Lehrende und Eltern dabei hilft, mit Kindern die Informationen zu verarbeiten.
In einer Welt, die stark von Medien beeinflusst ist, ist es wichtig, Kinder früh in Medien- und Nachrichtenkompetenz zu schulen. Und das war das Ziel des Projekts „Nachrichten für Kinder“. Es wurde bereits 2018 von Studierenden der HAW Hamburg entwickelt. Unter der Leitung von Vera Marie Rodewald und Silvia Worm erstellten diese ein sogenanntes Open Educational Resources (OER – ein offenes Lernangebot), um Lehrende, Lernende und Eltern in der Vermittlung und dem Verständnis von Kindernachrichten zu unterstützen.
Umgang mit Krisenthemen und Desinformation
Das Projekt, begleitet von den Figuren Toni und einem Eichhörnchen, bietet über die Website Zugang zu sieben thematischen Kapiteln. Diese behandeln unter anderem Gestaltungskriterien für Nachrichten und Medien, erklärt den kindgerechten Umgang mit Krisenthemen, beschäftigt sich mit Werbung, setzt sich mit der Bedeutung von Desinformation und Fake News auseinander und schafft eine Basis für die eigene Erstellung von Nachrichten für Kinder. Eine passende Handreichung gibt zusätzliche Erläuterungen und Nutzungshinweise. Das Beste: Die Inhalte stehen allen Interessierten für Bildungszwecke kostenlos zur Verfügung.
Diese Fragen beantwortet das Lernangebot „Nachrichten für Kinder“
Unser Leben und unsere Welt ist stark medialisiert – auch die von Kindern. Social Media spielt eine immer größere Rolle, doch wie gehen die jungen Menschen mit den Informationen um? In erster Linie müssen sie diese verstehen – wir brauchen also eine stärkere Medien- und Nachrichtenkompetenz, die mit diesem Lernangebot geschult wird. Es finden sich Antworten auf folgende Fragen:
- Wie unterscheiden sich Nachrichten für Kinder von solchen für Erwachsene?
- Wie müssen die Nachrichten formuliert sein, damit Kinder sie verstehen?
- Wie müssen die Nachrichten gestaltet sein? Welche Kriterien gibt es dabei?
- Wie lassen sich Fake News erkennen?
- Wie nutzen Kinder Medien und wie ist die Nutzung in den Alltag (im Gespräch mit Erwachsenen) integriert?
Auf der Website beleuchten die Lernmaterialien aus unterschiedlichen Blickwinkeln die Förderung von Nachrichten- und Medienkompetenz und zeigen die altersgerechte Darstellung von tagesaktuellen Ereignissen und Themen in der Zeitung, im Fernsehen, im Radio oder im Internet. Klicke dich gerne durch die Kapitel. Nutze die Inhalte außerdem kostenfrei für deine Publikationen und Lernmaterialien.

Headerbild: Dominic Wunderlich/Pixabay
14.12.2023 | Meena Stavesand
Weltklimakonferenz: Diese Projekte gehen die Herausforderungen des Klimawandels an
Anlässlich der Weltklimakonferenz in Dubai haben wir eine Liste von HOOU-Projekten zusammengestellt, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen. Es geht dabei um Gesundheit, Energie und Kraftstoffe.
Die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen findet jedes Jahr statt – 2023 war Dubai das Gastgeberland. Nach vielen Diskussionen und Debatten ging die diesjährige Zusammenkunft der fast 200 Staaten am 13. Dezember zu Ende – einen Tag später als geplant. Die internationale Politik feierte die Ergebnisse – so etwa die Abkehr von fossilen Brennstoffen als ein Kernpunkt. Es ist das erste Mal, dass die Weltgemeinschaft dazu aufruft, wenngleich kein Ende der fossilen Energien beschlossen wurde, was für Kritik sorgte. Es gibt aber Beschlüsse der Weltklimakonferenz, die Hoffnung machen, dass sich in der Weltgemeinschaft etwas bewegt:
- Die Erneuerbaren Energien sollen bis zum Jahr 2030 verdreifacht werden.
- Ein Fonds für klimabedingte Schäden und Verluste wurde eingerichtet.
- Methanemissionen sollen sinken.
- Die Landwirtschaft und der Lebensmittelsektor sollen beim Klimaschutz stärker Berücksichtigung finden.
- Das 1,5-Grad-Ziel wurde bekräftigt.
- Die Welt will Netto-Null-Emissionen bis zum Jahr 2050 erreichen.
Wie wichtig das Thema Klimawandel ist, zeigen nicht nur die Diskussionen vom 30. November bis 13. Dezember in Dubai, sondern auch zahlreiche Lernangebote an der HOOU. An verschiedenen Hochschulen haben sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit unserer Umwelt beschäftigt und kostenlose Kurse zur Verfügung gestellt. Es geht etwa um die Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Gesundheit oder um innovative Energiesysteme. Wir haben eine Liste der Lernangebote zusammengestellt:
1. CliMap-Health – Klimawandel und unsere Gesundheit
Welche Auswirkungen hat der Klimawandel eigentlich auf unsere Gesundheit? In unserem Lernangebot „CliMap-Health“ der HAW Hamburg wird genau diese Frage beantwortet. Als interaktive Weltkarte schafft es dieses E-Learning-Tool, praxisnahes Wissen über die Einflüsse von Klima und Umwelt auf unsere Gesundheit darzustellen. So geht es in den verschiedenen Abschnitten etwa um Smog-Probleme in Indien oder die Auswirkungen von Dürre und Waldbränden in Brasilien. Auch die Buschfeuer in Austrialien, die immer verherrender ausfallen, werden thematisiert. Es geht in dem Lernangebot darüber hinaus um Krankheiten wie Cholera im Jemen oder den Zika-Virus auf den Fidschi-Inseln. Lies mehr über die Bedrohungen und was Menschen unternehmen können. Außerdem gibt es einen spannenden Podcast zum Thema in Rahmen eines weitere Lernangebots. In dem Podcast „Let’s Talk Climate Action“ wird den Herausforderungen des Klimawandels auf die Gesundheit zusammen mit Expert:innen verschiedenster Forschungsdisziplinen und Handlungsfelder auf den Grund gegangen. Gerne reinhören!
2. RUVIVAL – Es geht um unsere Böden
Boden, Wasser- und Ernährungssicherheit sind stark miteinander verknüpft. Eine gute Bodenqualität ist eine der wichtigsten Grundlagen für die Nahrungsmittelproduktion und damit für unser Überleben. Auf immer weniger Fläche lässt sich Nahrung anbauen, während die Zahl der Menschen auf der Erde steigt. Dies bringt eine besondere Herausforderung mit sich, der wir uns stellen müssen. In dem Lernangebot „RUVIVAL“ der TU Hamburg zeigen wir Wissenswertes zu Boden, Wasser und auch Ernährung. Es geht dabei um den Anbau von Lebensmitteln, aber auch um den nachhaltigen, ökologischen Hausbau. Es gibt bei „RUVIVAL“ nicht nur interaktive Vorlesungen, sondern auch eine Toolbox. Diese enthält Wissen und Methoden, um das Land zu beleben, Synergieeffekte zu nutzen und ländliche Gebiete zu entwickeln. Themen sind etwa: nachhaltige Bewässerung, Regenwassernutzung, Viehzucht oder ländliche Energiesysteme.
3. Green Hydrogen – Wichtig für eine neue Energieversorgung
Grüner Wasserstoff ist ein Begriff, der immer wieder auftaucht, wenn es um nachhaltige Energieträger geht. Wie wichtig dieses Green Hydrogen ist, stellt das gleichnamige Lernangebot der TU Hamburg heraus. In dem kostenlosen Kurs der TU Hamburg erfährst du, wie Wasserstoff hergestellt, gespeichert, transportiert und genutzt werden kann und warum grüner Wasserstoff so wichtig für die Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare, treibhausgasneutrale Energieträger ist. In erklärenden Texten, Grafiken und Illustrationen sowie Aufzeichnungen von Fachvorträgen erhältst du einen umfassenden Überblick über die Hintergründe der Diskussion um den Einsatz von grünem Wasserstoff als Energieträger. Du kannst dir damit Wissen über die technologischen Grundlagen aneignen und verstehst die Zusammenhänge zwischen Wasserstoff und erneuerbaren Energien in zukünftigen, nachhaltigen Energiesystemen.
4. BioCycle – Jetzt Lebensmittelabfälle in Energie umwandeln
Was machst du mit deinen Obstschalen? Du wirfst sie wahrscheinlich weg – und das ist im Prinzip auch richtig, aber es steckt auch viel Energie darin, die wir nutzen können. Möglich ist das mit dem Ansatz von BioCycle. Dabei wird das, was wir als Abfall betrachten – wie eben unsere Gemüseschalen – in etwas Positives und Wichtiges verwandelt: in Energie und Nährstoffe. Wie das geht, erklären wir die in unserem Lernangebot BioCycle der TU Hamburg, mit dem wir den Lebensmitteln eine zweite Chance geben, indem wir ihren Lebenszyklus verlängern und sie in eine Form umwandeln, die uns und der Umwelt zugutekommt. Was auf den ersten Blick kompliziert klingt, ist es vom Prinzip aber nicht. Du musst deine Lebensmittel nur richtig trennen und sie dann kompostieren oder in einer Biogasanlage wie jener im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg recyclen.
5. Let’s Talk Climate! – Herausforderungen für die Gesundheit
Hitze, Extremwetterlagen, vermehrte Allergien, neuartige Infektionskrankheiten – die Bedrohung unserer Gesundheit durch den Klimawandel ist vielschichtig. Die Zunahme heißer Tage über 30 Grad – insbesondere über einen längeren Zeitraum – stellt eine Herausforderung und Belastung für den Menschen dar. Darum spricht das kostenlose Lernangebot Let’s Talk Climate! der HAW Hamburg vorrangig Studierende der Gesundheitswissenschaften und Public Health sowie Studierende beziehungsweise Auszubildende der Gesundheitsversorgungsberufe wie Pflege- bzw. Pflegewissenschaften, Medizin, Physiotherapie in der tertiären Bildung an. Wer den Kurs durchläuft, erwirbt ein grundlegendes Verständnis zu den direkten und indirekten Einflüssen klimatischer Veränderungen auf die menschliche Gesundheit. Darüber hinaus ermöglicht das Projekt Let’s Talk Climate! durch die Bereitstellung der Materialien unter einer offenen Lizenz die Bearbeitung und Weiterentwicklung der Inhalte, insbesondere der praxisnahen Fallbeispiele. Ebenso soll über diesen Charakter ein bestmöglicher niederschwelliger Transfer einzelner Materialien in die Berufspraxis ermöglicht werden.
6. Zukunftsweisende Kraftstoffe – was ist die Alternative zu Erdöl?
Verkehr ist ein riesiger Teilbereich des Klimaschutzes. Wie wollen wir uns in Zukunft fortbewegen? Welche Möglichkeiten gibt es? In dem Lernangebot „Zukunftsweisende Kraftstoffe“ der TU Hamburg geht es insbesondere um die Produktion verschiedener Kraftstoffe, die aktuell verfügbar sind oder in Zukunft eine wichtigere Rolle bei der Ersetzung von erdölbasierten Kraftstoffen einnehmen könnten. Außerdem werden potenzielle Rohstoffe thematisiert, die bei der Herstellung moderner Kraftstoffe zum Einsatz kommen könnten. Jedes Kapitel des Lernangebots ist in verschiedene Abschnitte unterteilt, die durch erläuternde Texte, Grafiken und zusätzliche Berichte, Artikel und Videos angereichert sind. So ist ein tieferes Verständnis garantiert. Außerdem gibt es auch den spannenden Podcast „Mobilcast“, der sich mit biogenen und strombasierten Kraftstoffen befasst. Das Lernangebot spannt daher einen interessanten Bogen und bringt alle wissenswerten Informationen zu dem Themenbereich auf den Punkt.
Auch im kommenden Jahr 2024 werden die Hochschulen der HOOU an Themen zum Klimawandel und Nachhaltigkeit arbeiten. Nach und nach werden wir die Projekte auf unserer Seite präsentieren.

Headerbild: StockSnap/Pixabay
13.12.2023 | hoouadmin
Logik des Programmierens auf spielerische Art lernen
An der HAW Hamburg entwickeln Studierende unterschiedlicher Studiengänge ein multimediales Spiel. Mit diesem können sich Interessierte auf niederschwellige Art Programmierkompetenzen aneignen.
Programmiertechnische Kompetenzen gehören zu den Schlüsselkompetenzen der Zukunft. Wie können diese Fähigkeiten auf niedrigschwelliger Ebene zugänglich gemacht werden? Na ganz einfach: Let’s make it a game! Denn Spielen ist die natürlichste, universellste und kulturübergreifende Form des Lernens, wie auch Mitchel Resnick’s Life Long Kindergarten (1) gezeigt hat.
In einem interdisziplinären Team entwickeln nun Studierende der HAW Hamburg aus unterschiedlichen Studiengängen ein multimediales Spiel, das den Nutzer:innen ermöglicht, sich mit Hilfe der Open Educational Resources (OER) „Learning by Playing“, die Logik des Programmierens auf spielerische Weise anzueignen und komplexere Aufgaben erfolgreich zu meistern. Unter Nutzung von Unity als Engine und Entwicklungsumgebung soll das modular aufgebaute Spiel erweiterbar sein. Das Motto dieses projektorientierten Lernens ist „Einfach spielen – Challenges meistern – Kompetenzen erweitern!“.
Interesse an Information wecken
Die OER richtet sich an alle Menschen, die sich programmiertechnische Kompetenzen spielerisch aneignen möchten. Der niedrigschwellige Zugang zum Programmieren über das Spiel verfolgt das Ziel, das Interesse an Informatik zu wecken und den Spieler:innen Schritt für Schritt programmiertechnische Kompetenzen über das eigene Tun zu vermitteln.
Mit dem Durcharbeiten des Spiels beherrschen Lernende zentrale programmiertechnische Grundlagen im Bereich der Logik des Programmierens. Wir freuen uns auf das Lernangebot!
(1) Resnick, M. (2017). Lifelong kindergarten: Cultivating creativity through projects, passion, peers, and play. (S. 19 ff) MIT press.
Text: Dorothee Wagner/HAW Hamburg

Headerbild: Katrin Schröder/MMKH
07.12.2023 | hoouadmin
So lässt sich ChatGPT spielerisch in den Unterricht integrieren
"Geschichte schreiben mit ChatGPT" - der Name des Lernangebots der HAW Hamburg ist Programm. Denn mit dieser kostenlosen Schritt-für-Schritt-Anleitung können Schüler:innen ihre eigenen Storys mithilfe von generativer KI entwickeln.
Veranstaltet von der Joachim Herz Stiftung fand am 27. und 28. November in Hamburg die Konferenz „Adaptives Lernen und KI in der schulischen und beruflichen Bildung: Potenziale und Herausforderungen technologiegestützten Lehrens und Lernens“ statt. Im Mittelpunkt standen die tiefgreifenden Veränderungen, die Künstliche Intelligenz in Lehr- und Lernprozessen auslösen kann und mit Sicherheit auch auslösen wird. Bei der Veranstaltung in der Langenhorner Chaussee drehten sich viele Fragen um intelligente tutorielle Systeme, die einerseits eine Arbeitserleichterung für didaktisch Tätige darstellen, andererseits die Diversität von Lerngruppen und deren individuelle Unterstützung fördern können.
HOOU-Projekt „Geschichte schreiben mit Chat GPT“ vorgestellt
Vor allem generative Chatbots und Co. bieten derzeit neue Ansätze im Bereich des adaptiven Lernens. So stellte Dr. Nicole Hagen von der HAW Hamburg im Rahmen der HOOU das Projekt „Geschichte schreiben mit ChatGPT“ eine Open-Source-Anleitung für Schulen vor, das sich vornehmlich an Schüler:innen und Lehrende richtet, die das Thema KI auf spielerische Weise in ihren Unterricht integrieren möchten.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erklärt hierbei, wie Schüler:innen mit Hilfe eines generativen Sprachmodells eine eigene Geschichte entwickeln können – mit oder ohne initiale Idee für eine Story. Dazu bieten die bereitgestellten Materialien zusätzliche Hilfestellungen zur Anregung der eigenen Fantasie und viele Inspirationsquellen. Der Leitfaden versteht sich als Orientierungshilfe. Darüber hinaus sind freies und kreatives Ausprobieren sowie der Einstieg in den Diskurs über Risiken und Potenziale von KI erwünscht.
Hohes Interesse an offenem Angebot: Projekt wird weiterentwickelt
Die Entwickler:innen des Angebots befinden sich aktuell in einer intensiven Testphase, um zu prüfen, was funktioniert und wo es mit den Large-Language-Modellen zurzeit eventuell noch hakt. Sie sammeln das Feedback der Teilnehmenden, um es in das Endprodukt einfließen zu lassen. Bisher erprobte Formate waren zum Beispiel die rein digitale Nutzung ohne Begleitung durch eine Lehrkraft über die Plattform Lehre:Digital zum deutschlandweiten Digitaltag. Im analogen Austausch mit einem vielfältigen Publikum zu den Festivitäten rund um den Tag der deutschen Einheit hat sich gezeigt, dass vor allem sehr junge und ältere Interessierte von einem solchen offenen Angebot profitieren. Auch die Durchführung als ChatGPT-Workshop für ganze Klassen auf dem Digital@School Campus 2023 der Telekomstiftung in Bonn erwies sich als zielführend.
Der Austausch mit dem interessierten Fachpublikum auf der Veranstaltung der Joachim Herz Stiftung brachte weitere Impulse und potenzielle Kooperationspartner. Nach diesem vielfältigen Input stehen die nächsten Planungsschritte in den Startlöchern.
Probiere das Angebot selbst aus: Der Chatbot ChatGPT kann ohne Registrierung direkt auf der Seite getestet werden!
Text: Dr. Nicole Hagen/HAW Hamburg

Headerbild: Gerd Altmann/Pixabay
06.12.2023 | hoouadmin
So verstehst du die Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Gesundheit
Klimabildung ist in der Hochschulpolitik und Lehre oft ein vernachlässigtes Thema - anders an der HAW Hamburg. Dort wird nun ein entscheidender Schritt in Richtung einer klimabewussten Ausbildung unternommen.
Der fortschreitende Klimawandel führt zu häufigeren und intensiveren Hitzewellen, wie auch im Sommer 2022, mit der Höchstaufzeichnung von 40,1 Grad Celsius über zwei Tage. Für die Sommer 2018 bis 2022 wurden insgesamt in Deutschland etwa 23.800 hitzebedingte Todesfälle durch Modellierung der Übersterblichkeit berechnet (vgl. Matthies-Wiesler et al., (2023): Auswirkungen von hohen Außentemperaturen und Hitzewellen auf Lungenerkrankungen. doi: 10.1007/s10405-023-00500-5.).
Doch wie oft wird in der Hochschulpolitik, in den Lehrplänen oder unter den Lehrenden das Thema Klimabildung thematisiert? Wie viele Lehrende sind mit dem Begriff der „Klimalehre“ vertraut? Die HAW Hamburg ist deutschlandweit eine unter 5 Hochschulen, die zum Thema Klimawandel und Gesundheit forschen und lehren. Das Ziel des neuen HOOU-Projekts Klima.Kompetent der HAW Hamburg ist die Verstetigung dessen an der Hochschule.
Studierende als Zielgruppe
Das Lernangebot Klima.Kompetent bemächtigt Lehrende und Lernende der HAW Hamburg für die Bewältigung der Herausforderung der Klimawandelauswirkungen in ihrer Disziplin. Drei der insgesamt 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen bilden dafür den Rahmen: Gesundheit und Wohlergehen (Nummer 3), Hochwertige Bildung (Nummer 4) und Maßnahmen zum Klimaschutz (Nummer 13).

Die fertige OER (Open Educational Resources – ein offenes Lernangebot für alle Menschen) hat zum Ziel, jetzige Studierende für ihre spätere Berufspraxis zu befähigen. Sie sollen in der Lage sein, Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerungsgesundheit ergreifen zu können und ein höheres Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu erlangen. Denn als Akteur:innen des Gesundheitssektors tragen sie eine besondere Verantwortung: als versorgende Professionen, in der gesundheitlichen Aufklärung und auch in ihrer Rolle als Forschende und politische Berater:innen. Hierzu gehört insbesondere die Vermittlung eines notwendigen Verständnisses der Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Gesundheit, um effektiv auf ihre Zielgruppen zuzugehen und selbst als Multiplikator:innen für Klimaschutz und -anpassung agieren zu können.
Let’s Talk Climate! als Vorgängerprojekt
Im Vorgänger-Projekt Let’s Talk Climate! wurden bereits die Bedarfe aus den Studiengängen Hebammenwissenschaften und Gesundheitswissenschaften mit Studierenden und Praktizierenden ermittelt. Auch in der jetzigen Projektphase sollen im Dialog mit Studierenden im Vorfeld sowie nach der Erprobung der Materialien im Unterricht, Anpassungen vorgenommen werden. Wir sind sehr gespannt auf das neue Lernangebot, an dem die Projektverantwortlichen derzeit arbeiten!
Text: Dorothee Wagner/HAW Hamburg

Hass im Netz; Foto: Niklas Hamann / unsplash
08.11.2023 | Meena Stavesand
Umgang mit Hass im Netz: Nicht schweigen, sondern Beweise sammeln und Hetze melden
Hass im Netz ist ein allgegenwärtiges Thema und betrifft sehr viele Menschen. Darum ist es wichtig, dagegen vorzugehen. Doch wie? In unserem Lernangebot „Don’t hate. Participate.“ der HAW Hamburg gibt es Handlungsempfehlungen für Lehrkräfte und Jugendliche, die sich gegen Online-Hetze stemmen wollen. Du findest darin Hintergrundwissen und Materialien, um etwa lokale Aktionstage zu den Themen „Hass im Netz“ und „Demokratiebildung“ zu organisieren.
Die Urheber:innen – MyGatekeeper genannt – geben im Interview auch Tipps, wie man mit Hass im Netz umgehen kann. Außerdem erläutern sie, welche Rolle soziale Netzwerke bei der Verbreitung von Hass spielen und warum Hetze unsere Demokratie gefährden kann.
Was kann ich tun, wenn ich Hass im Netz erfahre oder bei anderen Menschen Hetze erlebe? Wie verhalte ich mich?
Wer Hass im Netz erlebt oder bei anderen Menschen Hetze beobachtet, kann auf einige bewährte Maßnahmen zurückgreifen:
- Nicht schweigen: Ignorieren Sie Hass und Hetze nicht. Es ist wichtig, solche Inhalte nicht zu verbreiten, aber Sie können sie melden oder öffentlich darauf reagieren, um auf das Problem aufmerksam zu machen.
- Beweise sammeln: Wenn Sie belästigt werden, ist es ratsam, Beweise zu sammeln, indem Sie Screenshots machen oder Aufzeichnungen führen, um die Vorfälle später melden zu können.
- Melden Sie Hass: Nutzen Sie die Meldefunktionen der Plattform, auf der der Hass oder die Hetze stattfindet. Die meisten sozialen Medien haben Richtlinien gegen Hassrede und Hetze und werden Schritte unternehmen, um diese zu entfernen.
- Unterstützung suchen: Suchen Sie Unterstützung bei Freundinnen und Freunden, bei der Familie oder bei professionellen Beraterinnen und Beratern, um mit den emotionalen Auswirkungen von Hass und Hetze umzugehen.
Diese Maßnahmen basieren auf Forschungsergebnissen, die zeigen, dass aktives Eingreifen und Melden von Hass im Netz dazu beitragen können, die Verbreitung solcher Inhalte zu reduzieren und Opfern Unterstützung zu bieten.
Das sind die Ziele des Lernangebots „Don’t hate! Participate.“:
Habt ihr den Eindruck, dass Hass und Hetze im Netz zunehmen? Was könnten Gründe dafür sein?
Ja, es gibt Beweise dafür, dass Hass und Hetze im Netz zugenommen haben. Dies kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden:
- Anonymität: Die Anonymität im Internet ermöglicht es Menschen, sich weniger zurückzuhalten und aggressiver zu sein, als sie es offline wären.
- Soziale Medien: Sozialen Medien haben die Reichweite von Hassrede erheblich erhöht. Menschen können leichter und schneller Inhalte teilen und weiterleiten, was die Verbreitung von Hass beschleunigt.
- Politisierung: Politische Polarisierung in vielen Ländern hat dazu geführt, dass Menschen ihre Meinungen aggressiver und feindseliger äußern, was sich auch online widerspiegelt.
- Algorithmen: Die Algorithmen sozialer Medien neigen dazu, kontroverse oder aufmerksamkeitsstarke Inhalte zu fördern, was dazu führen kann, dass Hassrede und Hetze eine größere Reichweite erlangen.
Diese Beobachtungen stützen sich auf zahlreiche Studien und Berichte, die den Anstieg von Hassrede im Internet dokumentieren.
Ihr habt das Lernangebot „Don’t hate! Participate.“ erstellt. Was war eure Motivation?
In erster Linie ging es darum, ein Angebot zu schaffen, dass für Pädagog:innen und Jugendliche, die selbst gegen Online-Hass aktiv werden wollen, eine echte Hilfestellung sein kann. Der Name „Don’t hate. Participate.“ stammt von unserem Aktionstag im November 2019, den wir im Nachgang des Anschlags von Hanau organisierten. In Hanau hatte ein Attentäter neun Menschen mit Migrationshintergrund getötet.
Unser ursprünglicher Appell des Aktionstages lautete: „Jeden Tag verbinden sich engagierte Menschen und Organisationen, die für positiven Wandel stehen, über Social Media. Leider generieren aber oftmals die Diskussionen und Akteur:innen, die negative Emotionen auslösen, mehr Interaktion und Reichweite. Eine Konsequenz daraus ist, dass belegbare Fakten immer häufiger nicht als Realität anerkannt werden, sondern einem ,Realitätsgefühl‘ weichen, das auf unserem individuellen Medienkonsum basiert. Mit der Ausrichtung des Aktionstages möchten wir einen Beitrag dazu leisten, das Bewusstsein an den schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen in der Stadt und Region zu diesen Entwicklungen zu steigern. Wir möchten den teilnehmenden Schüler:innen Handlungsmuster, Inhalte und Werkzeuge vorstellen, die einen aufgeklärten und konstruktiven Umgang an der Schule mit diesen Themen ermöglichen. Gegen Hass und Ignoranz! Für politischen und gesellschaftlichen Aktivismus! Gegen Diskriminierung und Vorurteile! Für Toleranz und Respekt!“
Auch in der Podcastepisode von „Hamburg hOERt ein HOOU“ sprechen die Ersteller:innen über ihr Lernangebot und ihre Motivation dahinter.
Warum belastet Hass (im Netz) unsere Demokratie?
Hass im Netz belastet unsere Demokratie aus mehreren Gründen:
- Spaltung und Polarisierung: Hassrede fördert die Polarisierung der Gesellschaft, indem sie Menschen in extremistische Positionen treibt und die Kommunikation zwischen verschiedenen politischen Gruppen erschwert. Dies kann die Kompromissfähigkeit in politischen Prozessen gefährden.
- Einschüchterung und Zensur: Hass und Hetze können Menschen davon abhalten, sich politisch zu engagieren oder ihre Meinungen frei zu äußern, aus Angst vor Belästigung oder Anfeindungen.
- Desinformation: Hassrede kann zur Verbreitung von Fehlinformationen führen, die die öffentliche Meinung und politische Entscheidungen beeinflussen. Menschen könnten manipuliert werden, um gegen ihre eigenen Interessen zu stimmen.
- Vertrauensverlust in Institutionen: Wenn Hass und Hetze im Netz ungehindert grassieren, kann dies das Vertrauen der Bürger in demokratische Institutionen und den politischen Prozess selbst untergraben.
Diese Auswirkungen von Hass auf die Demokratie sind gut dokumentiert und betonen die Bedeutung der Bekämpfung von Hass im Netz, um die Integrität und Stabilität demokratischer Gesellschaften zu erhalten.

Diskutiere mit uns über . Bild: Brooke Cagle
27.10.2023 | hoouadmin
HAW Hamburg: Entwickelt mit uns beim Jupitercampus drei Lernangebote
Am Samstag, 4. November, ist die HOOU@HAW beim Jupitercampus. Wir möchten für die Entwicklung von drei Lernangeboten im Bereich der Sustainable Development Goals herausfinden, welche Bedarfe die Bevölkerung in dieser Thematik hat.
Was ist das Projekt „Zugang für Alle – auf dem Weg zu barrierefreien Lernmaterialien“?
Wir laden euch dazu ein, mit uns gemeinsam zu entdecken, wer die Zielgruppe für das Lernangebot „Zugang für Alle – auf dem Weg zu barrierefreien Lernmaterialien” sein könnte und wie die Beteiligten am liebsten lernen möchten. Ihr lernt in diesem Workshop am 4. November von 10 bis 12 Uhr die HOOU kennen, erfahrt was wir im Rahmen des jeweiligen Projekts umsetzen wollen und tragt dazu bei, dass das Lernangebot richtig gut wird. Wir diskutieren, malen, basteln und entwickeln gemeinsam Visionen für ein zeitgemäßes Lernen mit den drei Schwerpunkten:
- Warum interessiert ihr euch für das Thema des jeweiligen HOOU-Projekts?
- Was wollt ihr dazu lernen?
- Wie wollt ihr lernen?
Was ist das Projekt „Biodiversität und ich“?
Biodiversität und Klimawandel sind die großen gesellschaftlichen Themen unserer Zeit. Doch die Dramatik des Artenverlusts und die Dringlichkeit von Maßnahmen zum Schutz der biologischen Vielfalt sind vielen Menschen in dieser Gesellschaft noch nicht bewusst.
In unserem multimedialen Lernangebot wollen wir ein Verständnis für die komplexen Zusammenhänge in Ökosystemen schaffen. Zudem erstellen wir eine Simulation, mit der verschiedene Faktoren und ihre Wirkung auf das eigene Leben getestet werden können. Lasst uns bei dem Workshop am 4. November von 13 bis 15 Uhr gemeinsam herausfinden, was wir in das Lernangebot aufnehmen müssen.
Was ist das Projekt „klima.kompetent“?
Mit unserem Projekt „klima.kompetent“ wollen wir zukünftige Akteur:innen aus verschiedenen Gesundheitsdisziplinen zu Expert:innen ausbilden. In Form von interaktiven und fallorientierten Materialien sollen sie passgenau dazu ermächtigt werden später den Wissenstransfer in ihrem Beruf leisten zu können. Zu diesem Lernangebot könnt ihr bei dem Workshop am 4. November von 16 bis 18 Uhr beitragen.
Die Workshops im Überblick:
10 bis 12 Uhr: Entwickle gemeinsam mit uns Ideen für das Lernangebot „Zugang für Alle“
13 bis 15 Uhr: Entwickle gemeinsam mit uns Ideen für das Lernangebot „Biodiversität in Gewässern“
16 bis 18 Uhr: Entwickle gemeinsam mit uns Ideen für das Lernangebot „klima.kompetent“