Autor: hoouadmin

Axel Dürkop vor der Biogasanlage. Bild: Paula O. Gugliemli
24.06.2025 | hoouadmin
Außergewöhnliche Wege zur Wissenschaft und in eine nachhaltige Zukunft
Mit Axel Dürkop wird es nie langweilig: Der wissenschaftliche Mitarbeiter der TU Hamburg bringt kreative Ideen und Teamgeist zusammen, um digitale Lernangebote in Kunstwerke zu verwandeln. Im Gespräch mit Dr. Paula O. Guglielmi zum 10. Geburtstag der HOOU berichtet er von den WATTwanderungen in Hamburg – einem Projekt der HOOU an der TU Hamburg, das wissenschaftliche Themen Menschen auf kreative Weise zugänglich macht und den Dialog zwischen Hochschulen und Gesellschaft fördert. Im Mittelpunkt steht dabei immer eines: eine nachhaltige Zukunft für unsere Welt. Und die nächste Ausgabe des BioGAStmahls im Rahmen der WATTWanderungen findet bereits am kommenden Samstag, 28. Juni, um 12 Uhr bei der altonale statt. Mehr Infos gibt’s hier.
Mit seinem Theaterhintergrund gibt Axel komplexen wissenschaftlichen Inhalten eine Bühne, auf der sie in künstlerischer und partizipativer Form aufgeführt werden. Diese innovativen Formate bieten einen niederschwelligen Zugang für Menschen, die sich sonst nicht mit komplexen wissenschaftlichen Themen auseinandersetzen würden. Darüber hinaus ermöglichen sie den Dialog und Austausch zwischen Forschenden und verschiedenen Menschen aus der Gesellschaft.
Wie schaffen wir die Energiewende?
Beim Projekt „WATTwanderungen in Hamburg“ geht es um die Energiewende. Wie schaffen wir diese? Wie kann jeder und jede von uns dazu beitragen, eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten? Das Projekt setzt auf sinnliche Erfahrungen und Partizipation. Ob beim gemeinsamen Kochen mit Biogas, bei einer Kinovorführung im Park oder während einer Fahrradtour – die Veranstaltungen laden ein, Nachhaltigkeit nicht nur zu verstehen, sondern zu erleben.
Mit dem Fahrrad sind wir zu einigen dieser Energieorte gefahren, in denen Veranstaltungen der WATTwanderungen stattgefunden haben. Axel erzählt uns dabei, wie das Projekt entstanden ist, wer die Kooperationspartne*innen sind und was bereits passiert ist.

„Bildung bedeutet für mich, dass man sich als Persönlichkeit weiterentwickelt. Und das passiert nur, wenn Menschen zusammen sind. Das passiert selten vorm Computer.“Axel Dürkop
Seit 2012 arbeitet Axel als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Hamburg. Sein Interesse für Bildung und Befähigung von Menschen hat jedoch viel früher angefangen. Nachdem er viele Jahre als Darsteller und Regisseur am Theater gearbeitet hat, hat der studierte Philosoph sich autodidaktisch im Bereich Creative Commons, freie Software und Programmiersprachen weitergebildet.
Acht Jahre lang hat er als freiberuflicher Dozent für Webtechnologien und Computer in unterschiedlichen Weiterbildungseinrichtungen und Schulen gearbeitet. Der Umgang mit Menschen war für ihn dabei sehr wichtig. „Bildung bedeutet für mich, dass man sich als Persönlichkeit weiterentwickelt. Und das passiert nur, wenn Menschen zusammen sind. Das passiert selten vorm Computer“, ergänzt Axel.
Menschen für Wissenschaft begeistern – auf untypischen Wegen
Mit diesem Gedanken hat er die WATTwanderungen in Hamburg konzipiert. „WATT“ ist die Maßeinheit für Energieleistung und „Wanderungen“ bedeutet dabei, dass man zu Orten geht, an denen erneuerbare Energien produziert werden, um dort Veranstaltungen zu machen, die kultureller Natur sind“, erklärt Axel und ergänzt: „Mein Ziel ist es, Menschen über einen völlig untypischen Zugang für wissenschaftliche Themen zu interessieren.“
Für Axel ist das wichtig, denn: „Die Themen der Hochschulen beeinflussen das Leben vieler Menschen und sollten daher von einer repräsentativen Zusammensetzung der Gesellschaft diskutiert werden.“ Die „WATTwanderungen“ haben 2022 den Förderpreis Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) erhalten. Axel ist für diese Förderung sehr dankbar: „Wir erhielten Sachmittel mit Vertrauensvorschuss und der Erlaubnis, kreativ zu experimentieren. Damit konnten wir Dinge entstehen lassen, die wir vorher gar nicht wussten.“
Biogas aus den Wilhelmsburger Zinnwerken
Die erste Veranstaltung der „WATTwanderungen“ hat in den Wilhelmsburger Zinnwerken stattgefunden. „Die Kooperation mit den Zinnwerken entstand durch Steffen Walk, den Projektdurchführenden vom Lernangebot ‚BioCycle‘. Bei einem Treffen lernte ich Beate Kapfenberger und die anderen Personen kennen, die die Biogasanlage in Wilhelmsburg aufgebaut hatten.
Schnell entwickelte sich eine gemeinsame Begeisterung für die Zusammenarbeit. Gemeinsam mit Steffen entwickelte ich die Konzeption, bei der Besucher*innen während vier Wochen ihren Küchenabfall sammeln und zur Anlage bringen konnten. Dort wurde der Abfall gewogen, sortiert und anschließend zu Biogas verarbeitet.
Als Dankeschön erhielten die Spender*innen ein Essen, das mit dem erzeugten Biogas zubereitet wurde“, erzählt Axel. So entstand die Veranstaltung „BioGAStmahl“, bei der Teilnehmende lernten, wie Abfälle korrekt getrennt werden, wie Biogasanlagen funktionieren und welche Rolle die Kreislaufwirtschaft für Lebensmittel spielt – technische Themen, die an der TU Hamburg erforscht werden.
Anlage produziert neben Biogas auch Flüssigdünger
Das nächste „BioGAStmahl“ hat in Altona stattgefunden: „Neben Biogas produziert die Anlage auch Flüssigdünger. Nach einem Gespräch mit Karin Haenlein vom KulturEnergieBunkerAltonaProjekt (KEBAP) e.V. entwickelte sich ein stadtteilübergreifendes Konzept: Während des ersten ‚BioGAStmahls‘ in Wilhelmsburg kochte die Kochgruppe von KEBAP. Im Tausch erhielten sie Dünger, den sie für ihr Gartenbeet vor dem Bunker in Altona nutzen konnten. Im Gegenzug kamen die Wilhelmsburger*innen nach Altona, um mit dem gedüngten Gemüse zu kochen – eine stadtteilübergreifende Kreislaufwirtschaft. Die Umsetzung war nicht einfach, denn es dauerte lange, bis alle Genehmigungen für den Transport des Biogases in Säcken per Lastenfahrrad erteilt waren“, berichtet Axel.
Die Bemühungen haben sich gelohnt: Als „BioGAStspiel“ wurde zweimal in Altona mit Biogas aus Wilhelmsburg gekocht. Einmal beim KEBAP und einmal an der Christianswiese in Altona, in Kooperation mit der altonale GmbH.
Großes Kino mit Solarenergie
Ein weiterer Schwerpunkt der „WATTwanderungen“ ist die Energiegewinnung aus der Sonne. In Kooperation mit dem KEBAP fanden zwei Veranstaltungen statt: Im Workshop „Libre Solar Box“ vermittelte Michel Langhammer die Speicherung und Nutzung von Solarenergie mit Open-Source-Hardware. Dabei verwies er auf das HOOU-Lernangebot „Libre Solar“.
Zudem wurde beim Open-Air-Kino „KinoSOLAR“, das mit Solarenergie aus einem Anhänger betrieben wurde, das Bewusstsein für nachhaltige Energienutzung durch Filme zur Energiewende und zum Klimawandel gestärkt. „So konnten wir im KulturEnergieBunker in Altona diese Dreiheit, die wir in den ‚WATTwanderungen‘ anstreben, vollenden: das praktische, ästhetische und theoretische Zusammenkommen von Workshop, Kino und Lernangebot“, ergänzt Axel.

Dort hingehen, wo die Menschen sind
Die Bücherhallen Hamburg sind ebenfalls eine wichtige Kooperationspartnerin der „WATTwanderungen“. Dort wurden die Vorbereitungsworkshops für das Klimaparlament durchgeführt, ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit den Künstler*innen Judith Henning, Amelie Hensel und Christoph Rothmeier umgesetzt wurde. „Das Klimaparlament wurde unter das Konzept der ‚menschlichen Vorstellungskraft als erneuerbare Energieform‘ untergeordnet.
Diese innovative Kategorie ermöglichte es, Projekte zu integrieren, die sich mit Fantasie, Visionen und nicht eindeutig zuordenbaren Aspekten beschäftigten“, ergänzt Axel. Die Kooperation mit den Bücherhallen hat allerdings viel früher angefangen. Bereits im Jahr 2019 veranstaltete Axel zusammen mit Dr. Lars Schmeink die Veranstaltungsreihe „Technik, Ethik, Zukunft – was denkst du?“ in der Zentralbibliothek. Auch dort wurde 2023 der Learning Circle „Bau deinen eigenen Roboter!“ angeboten.
Im Anschluss wurde das „Robo Festival“ veranstaltet, in dem verschiedene Aktivitäten eine spielerische Auseinandersetzung mit dem Thema Robotik ermöglichten. Um die 230 Leute haben das „Robo Festival“ besucht. „Dafür braucht man so eine Institution wie die Bücherhalle. Die Zentralbibliothek hat samstags eine Reichweite von etwa 3000 Besucher*innen. Eine offene Veranstaltung hier ermöglicht Kontakte zu Menschen, die man nie erreichen würde, wenn man sie irgendwo hin einlädt, wo sie nicht sowieso schon sind“, erläutert Axel.
Noch mehr Menschen für Energiewende sensibilisieren
Zurzeit plant Axel die nächsten Veranstaltungen, um mehr Menschen für die Energiewende zu sensibilisieren und eine größere Reichweite zu erzielen. Die „WATTwanderungen“ haben eine zweite Runde verdient, um bestimmte Formate zu wiederholen.
„Nur weil man eine Veranstaltung einmal gemacht hat, heißt das noch lange nicht, dass alle diese mitgekriegt haben“, ergänzt Axel. Wir dürfen daher gespannt bleiben und uns auf die nächsten „WATTwanderungen“ freuen!

Glenn Carstens-Peters / unsplash
26.03.2025 | hoouadmin
Wissen teilen, Offenheit leben: Open Education und Open Access an der TUB
Offenheit und Bibliotheken – das passt sehr gut zusammen, findet Florian Hagen, Fachreferent für Open Access und Open Education an der Universitätsbibliothek (TUB) der Technischen Universität Hamburg. Im Rahmen der Projektförderung der HOOU an der TU Hamburg hat er 2018 sowie 2019/2020 die Projekte „Wissenschaftliches Arbeiten öffnen“ und „tub.torials“ maßgeblich gestaltet. Ein Interview von Dr. Jana Panke (TU Hamburg).
Was können wir uns unter Open Education und Open Access vorstellen?
Florian Hagen: Zum einen unterstütze ich die Forschenden an der TUB beratend. Das heißt, dass ich zum Beispiel recherchiere, in welchem Journal der Artikel veröffentlicht werden könnte oder welche Publikationsalternativen zur Verfügung stehen. Außerdem berate ich rund um urheberrechtliche Fragen: Was ist zu beachten, wenn ich eigene Fotos in meinem wissenschaftlichen Beitrag nutzen möchte? Und natürlich muss ich den aktuellen Forschungsstand zu „Open Access“ kennen. Das ist, grob beschrieben, die eine Seite meiner Stelle.
Für den Bereich „Open Education“ muss ich etwas mehr ausholen. Von der TUB bieten wir das Seminar „Wissenschaftliches Arbeiten“ an. Hier haben wir deutlich mehr Anmeldungen als Seminarplätze. Auf 30 Plätze kommen ca. 100 bis 200 Anmeldungen pro Semester. Hieraus ist die Idee zum Projekt „Wissenschaftliches Arbeiten öffnen“ entstanden. Dieses wurde 2018 von der HOOU gefördert. Im Rahmen des Projektes ist auch die Idee für ein Blog entstanden, um Inhalte aus dem Seminar nach außen zu tragen. Im Seminar wird eine komplette wissenschaftliche Arbeit verfasst.
Auf diese möchten wir auch Feedback geben. Viele Studierende haben bis zu diesem Zeitpunkt noch keine wissenschaftliche Arbeit geschrieben – in vielen technischen Fächern stehen zunächst unter anderem eher Laborbücher, technische Berichte oder auch Dokumentationen im Vordergrund. Daher spielen wir das wissenschaftliche Arbeiten und Schreiben einmal von A bis Z durch. So versuchen wir den Druck für Studierende, für die zukünftige wissenschaftliche Karriere oder eben oft in dem Fall die Abschlussarbeit, zu nehmen, damit sie sich sicherer in ihrem zukünftigen Forschungsfeld fühlen.
Wie definierst du Open Access und Open Education?
Florian Hagen: Bei Open Access würde ich von der wissenschaftlichen Kommunikationsarbeit oder vom wissenschaftlichen Publizieren sprechen. Und dies bedeutet nicht, dass Dokumente, also beispielsweise ein Beitrag in einer Fachzeitschrift, einfach nur als PDF-Dokument zum Herunterladen ins Internet gestellt werden, sondern dass es zum Beispiel auch eine eindeutige Lizenz zu diesem Dokument gibt. So ist dann direkt klar, welche Nutzung mir von Seiten der Autor:innen erlaubt ist. Hier sind die CC-Lizenzen immens wichtig. Und Open Access erleichtert dahingehend natürlich die Forschung.
Open Education oder auch offene Bildung ist für mich eine Bildungspraktik, bei der in meinem Fall vor allem Lehrende und Studierende (und mittlerweile auch Kolleg:innen und einfach interessierte Menschen aus völlig anderen Arbeitsbereichen) frei zugängliche, lizenzierte Materialien nutzen, um auf neue (bzw. mittlerweile einfach andere) und spannende Weise mit Lerninhalten zu interagieren. Natürlich ist ein großer Aspekt, dass Menschen, wo immer sie auch sind, ohne oder mit möglichst geringen Barrieren konfrontiert werden, wenn sie lernen bzw. sich weiterbilden möchten. Das ist mir wichtig.
Im Mittelpunkt offener Bildung stehen oftmals die offene Bildungsressource selbst. Spannend finde ich aber auch den Blick über diese frei lizenzierten Ressourcen hinaus auf Themen wie Kollaboration bei offener Bildung und damit verbundenen Fragen wie „Hat schon jemand anders etwas zu einem Thema gemacht und könnte man darauf aufbauend ggf. zusammenarbeiten oder die Idee für den eigenen Kontext anpassen?“. Ebenso eröffnet die Möglichkeit, durch offenes Feedback OER-Elemente zu optimieren, neue Perspektiven.
Was bedeutet Offenheit für dich?
Florian Hagen: Grundsätzlich bedeutet Offenheit für mich, dass ich verschiedene Perspektiven berücksichtige und nicht nur in der gewohnten (Informations-)Umgebung bleibe, weil ich mich dort wohlfühle. Zum Beispiel, wenn es konstruktive Ideen zu einer Herausforderung gibt, dann bedeutet Offenheit für mich, dass ich reflektiere, ob diese Idee mich weiterbringen kann. Oder auch, dass ich ein Ohr dafür habe, mit welchen Themen sich andere Personen beschäftigen, wie sie an Dinge herangehen und auch in den Austausch zu gehen, um zu schauen, ob dies meiner eigenen Arbeit zugutekommen könnte.
Kurz gesagt: die eigenen Scheuklappen abnehmen und in Verbindung mit lebenslangem Lernen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass die Welt nicht stehenbleibt.
Das Thema Offenheit an sich im Zusammenhang mit Open Education finde ich auch spannend. Für mich war das anfangs ein größerer Umgewöhnungsprozess. Ich verstecke meine Lehr-Lernmaterialien und Ideen nicht mehr in meiner Schublade, bis sie nach unzähligen Überarbeitungsversuchen im engen Rahmen genutzt werden können. Irgendwann müssen sie raus. Und zwar so, dass sie auch wirklich möglichst leicht nachgenutzt und eventuell angepasst oder verbessert werden können.
Wie passen Bibliotheken und Offenheit zusammen?
Florian Hagen: Bibliotheken stehen in meinen Augen traditionell für den freien Zugang zu Wissen. Durch die vielen Entwicklungen in der digitalen Welt erlebt dieses klassische Prinzip unter anderem mit Open Access, Open Source und Open Data seit vielen Jahren ein Revival. Wenn wir in unserem Fall auf die TUB schauen, so gibt es hier seit vielen Jahren Bemühungen um verschiedene Openness-Entwicklungen. Seit 2002 wird für die Unterstützung der Forschung über die Universitätsbibliothek Open-Access-Repository TORE angeboten und seit vielen Jahren gibt es einen Publikationsfonds.
Die TUB engagiert sich auch regelmäßig bei vielen Projekten rund um Openness. Im Rahmen des Hamburg Open Science-Programmes beteiligte sich die Universitätsbibliothek unter anderem am Projekt „Modernes Publizieren“, in welchem eine Prozesskette entwickelt wurde, die zum Beispiel einerseits das gemeinsame Schreiben in einer Forschungsgruppe unterstützt, andererseits andere Wege beim Peer-Review-Prozess geht und zugleich eine Publikation in einem Open-Access-Journal ermöglicht. Ein wichtiger Baustein war hier auch Open-Source-Software wie das GitLab der TUHH.
Und im Rahmen der Projektförderung der HOOU an der TUHH wurden auch zwei Projekte sehr erfolgreich durchgeführt, deren Ergebnisse heute noch in verschiedener Form fester Bestandteil des Serviceangebots der Bibliothek sind. Zum einen das vorhin erwähnte und sehr nachgefragte NTA-Seminar zum wissenschaftlichen Arbeiten an der TUHH und zum anderen das nach wie vor regelmäßig bespielte Blogangebot tub.torials.
Darüber hinaus bieten Bibliotheken natürlich grundsätzlich Zugang zu einer breiten Palette von Informationen, unabhängig von politischen, wirtschaftlichen oder ideologischen Interessen, um so letztlich eine informierte und offene Gesellschaft und Kultur zu fördern. Dies zeigt sich auch in der Öffentlichkeitsarbeit, wo unter anderem auch die Beteiligung an nationalen und internationalen Initiativen und Events wie der jährlichen Open Access Week eine Rolle spielt, um den offenen Austausch von Wissen und Ideen zu fördern. Das sollen nur einige Beispiele sein, die auch dazu führten, dass der Einsatz der TUB mit dem Open Library Badge ausgezeichnet wurde und die aufzeigen, dass Bibliothek und Offenheit einfach zusammengehört.
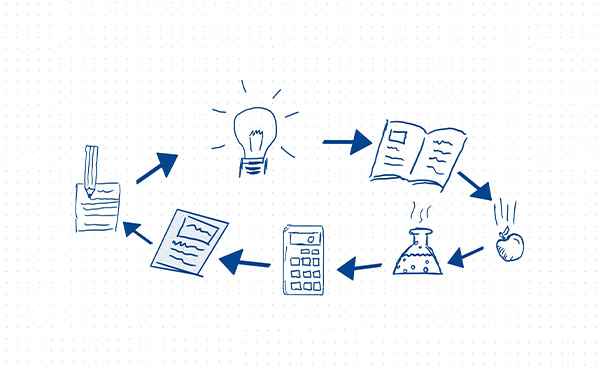
tub.torials - Gedanken, Ideen und Materialien zu Offenheit in Forschung und Lehre
tub.torials widmet sich in Textform und über interaktive Elemente dem Thema Offenheit im Kontext von Wissenschaft, Forschung sowie Lehre.
Du hast gerade die beiden HOOU-Projekte erwähnt. Beschreibe sie gerne einmal in deinen Worten.
Florian Hagen: Das erste Projekt war 2018 „Wissenschaftliches Arbeiten öffnen“, durch das ich auch an die TUB kam. Das zweite Projekt war 2019 und 2020 das Blog tub.torials.
Im Projekt „Wissenschaftliches Arbeiten öffnen“ wurde ein neues Seminarkonzept erarbeitet, dass das seit 2013 angebotene Seminar „Wissenschaftliches Arbeiten“ didaktisch und inhaltlich im Hinblick auf die Entwicklungen im Wissenschaftsbereich auffrischte und Inhalte aus dem Seminar für alle Interessierten zugänglich machte.
Natürlich hat das Seminar weiterhin als roten Faden den idealtypischen Prozess von der Ideenfindung und Recherche, über den Schreibprozess bis hin zur Publikation und der Präsentation der Arbeitsergebnisse. Daran haben wir nichts geändert. Open Access und Entwicklungen in der wissenschaftlichen Publikationslandschaft sind inzwischen aber große Themen geworden, die wir auch im Seminar behandeln.
Auf dem Blog „tub.torials“ werden regelmäßig offene Bildungsmaterialien rund um den Life-Cycle wissenschaftlicher Kommunikation veröffentlicht. Der Schwerpunkt des Angebots ist die Bereitstellung von OER, die auch in den Serviceangeboten der TUB, wie zum Beispiel Beratungsgespräche und Seminare zum wissenschaftlichen Arbeiten, zum Einsatz kommen.
Außerdem werden im Blog auch Ideen, Erlebnisse und Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag offen festgehalten. Hierzu gehören zum Beispiel Berichte von besuchten Veranstaltungen oder auch Erfahrungen mit verschiedenen Anwendungen und Workflows.
Aus beiden HOOU-Projekten ist in Kooperation mit dem bereits erwähnten Hamburg Open Science Projekt „Modernes Publizieren“ die Veröffentlichung „Mehr als 77 Tipps zum wissenschaftlichen Arbeiten“ entstanden. Und das finde ich klasse, dass es Schnittpunkte zwischen den Projekten gab, genauso wie es Berührungspunkte in meiner Arbeit gibt: zwischen der offenen Wissenschaft und den offenen Lehr- und Lernmaterialien.
Und hier wären wir wieder beim Thema Openness: damit gibt es eine Art Flexibilität. Man findet etwas, findet das total gut, obwohl es aus einem anderen Anwendungskontext stammt, und kann es dann durch das Remixen auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Dadurch entsteht auch häufig ein spannender Austausch und man kann voneinander lernen. Wo wir nun wieder beim Stichwort des lebenslangen Lernens wären, denn genau das ist es ja.
Ein paar Beispiele dazu: wir haben an der TUB viele Erfahrungsberichte und Anleitungen zu Literaturverwaltungsprogrammen verfasst. Und wir haben immer wieder interessierte Gäste aus dem Ausland, die diese gerne an ihrer Bibliothek nutzen und anbieten möchten. Durch die offene Lizenzierung stellt dies kein Problem dar und die Texte müssen nur noch übersetzt werden, was heutzutage mit KI-Unterstützung auch schnell geht. Und so machen dann die Materialien ihre Runden. Manchmal erhält man eine Rückmeldung zur Nutzung, manchmal auch nicht.
Um noch ein Beispiel zu nennen: wir hatten versucht, den Begriff Open Science bildlicher darzustellen und haben den Open Science Regenschirm entworfen. Hier haben wir viele Rückmeldungen zur Weiternutzung erhalten – das freut einen natürlich immer! Oder auch, dass ich auf Tagungen über Remixe von unseren Veröffentlichungen aufmerksam werde. Und konstruktives Feedback oder Verbesserungsvorschläge zu den Materialien, sei es von Kolleg:innen oder auch Studierenden, sehe ich als Geschenk.
Was hast du selbst durch deine HOOU-Projekte gelernt und für deine tägliche Arbeit mitgenommen?
Florian Hagen: Das erste, was mir bei dieser Frage in den Sinn kommt ist, dass ich viele tolle Leute kennengelernt habe. Menschen, mit denen ich gerne rede und mit denen ich gerne zusammenarbeite. Menschen, die mir vorgelebt haben und vorleben, dass es gut ist offen für Vieles zu sein. Für andere Perspektiven auf Dinge und Meinungen, für konstruktives Feedback, aber auch dafür, immer wieder aus der eigenen Komfortzone einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Auch wenn man also zum Beispiel seine geliebten Tools und Arbeitswerkzeuge im Arbeitsalltag hat, lohnt es sich Alternativen auszuprobieren. Mal, um einen anderen Blick auf etwas zu gewinnen. Mal, um perspektivisch auf sich dynamisch entwickelnde Arbeitsprozesse auch flexibel reagieren zu können und nicht zu sehr in den eigenen Gewohnheiten festzustecken.
Ich glaube, im Rahmen der HOOU fielen in der einen oder anderen gemeinsamen Projektrunde die Begriffe „Toolbox“ und „survival kit“. Zu meinem „survival kit“ zählen für mich neben einigen digitalen Werkzeugen die Kolleg:innen, mit denen man sich einfach mal gegenseitig Gedanken und Ideen zuwerfen kann, um voranzukommen. Dafür fand ich auch den HOOU-Hackerspace immer sehr schön.
Kannst du die beiden HOOU-Projekte in wenigen Worten beschreiben?
Florian: Ich versuche es: Türöffner, Vernetzung, Offener Blick und Reflexionswerkzeug.
Was ist dein Wunsch für die nächsten 10 Jahre HOOU@TUHH?
Florian: Ein jahresübergreifender Ideenaustausch mit allen ehemaligen HOOU-Projekten wäre schön!
Über Florian Hagen

Florian Hagen absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (FaMI) und erwarb im Anschluss einen Bachelorabschluss im Bereich Bibliotheks- und Informationsmanagement. Darauf folgte ein Masterstudium in Information, Medien, Bibliothek (IMB). Sein Fokus liegt auf den Themen Open Access, Open Education und Literaturverwaltung. Zudem ist er aktuell für die Ausbildungskoordination an der TUB zuständig.

Bild: Jorge Gordo/Unsplash
31.05.2024 | hoouadmin
HOOU beim Blurred Edges Festival: Ein Paradies für experimentelle Musik in Hamburg
Heute, am 31. Mai, startet das Blurred Edges Festival in Hamburg und verspricht mehr als zwei Wochen voller musikalischer Highlights. Mit Konzerten, Performances, Musiktheater, Lectures, Multimedia-Performances und Klanginstallationen bietet das Festival in seiner 19. Auflage so viele Veranstaltungen wie noch nie zuvor. Diese Vielfältigkeit macht das Festival zu einem einzigartigen Kaleidoskop der experimentellen Musikszene.
Die HOOU ist natürlich ebenfalls mit spannenden Akteur:innen vertreten. Wir zeigen dir, wer seine Kompositionen, Improvisationen und Klanginstallationen beim Blurred Edges Festival in diesem Jahr präsentiert und wie du in inspirierenden Lernangeboten dieser Expert:innen weitere Informationen zu der Musik erhältst.
Radikale Selbstbestimmung
Wie jedes Jahr steht das Festival unter dem Zeichen der radikalen Selbstbestimmung. Alle Hamburger Kulturschaffenden, die mit experimenteller Musik in Berührung kommen, konnten eine Veranstaltung vorschlagen.
Das Ergebnis ist eine bunte Mischung aus Kompositionen, freier und Konzept-Improvisationen, Klanginstallationen und Performances. Diese finden sowohl solo als auch in größeren Ensembles statt, wobei manche Gruppen eigens für das Festival zusammengestellt wurden, während andere bereits seit Jahren zusammenarbeiten.
Entdecke die Vielfalt der Hamburger Musikszene – in Galerien oder Bibliotheken
Das Publikum hat die Möglichkeit, die Vielfalt der Hamburger Musikszene zu entdecken und gleichzeitig die verschiedenen Kulturorte der Stadt zu erkunden. Von Galerien und Kunsträumen über Theater und Clubs bis hin zu Kirchen, Kinos und Bibliotheken – bekannte und weniger bekannte Orte bieten eine Bühne für die experimentelle Musik jenseits des Mainstreams und der Genregrenzen.
Das Blurred Edges Festival 2024 umfasst insgesamt 72 Veranstaltungen an 37 Orten in Hamburg und läuft über 17 Tage. Diese Vielfalt und die besondere Atmosphäre machen es zu einem Muss für alle Liebhaber:innen der experimentellen Musik.
Multimedia-Auftritte der HfMT beim Blurred Edges Festival
Einige talentierte Musikerinnen und Musiker der Hochschule für Musik und Theater werden in diesem Jahr beim Blurred Edges Festival auftreten. Hier eine Übersicht über ihre Performances:
Multimedia Composition
Sa., 1. Juni, 20 Uhr, Hochschule für Musik und Theater (Harvestehuder Weg 12 / Eingang: Milchstraße)
Die Studierenden des „Multimedia Composition“ Masters präsentieren an diesem Abend eine faszinierende Auswahl interdisziplinärer und audiovisueller Werke. Der Konzertabend bietet einen umfassenden Einblick in das vielfältige Schaffen an der Schnittstelle von digitaler Kunst, musikalischer Performance und Installation.
Wiederkehrende Themen der beteiligten Künstler:innen sind virtuelle Räume, digitale Körper, artifizielle Identitäten und künstliche Welten. Diese Konzepte werden in den präsentierten Arbeiten auf innovative Weise erforscht und dargestellt, wodurch ein einzigartiges Erlebnis für das Publikum entsteht. Nach dem Konzert haben die Besucher die Möglichkeit, mit den Künstler:innen ins Gespräch zu kommen und mehr über deren Inspirationen und Arbeitsprozesse zu erfahren.
Es werden Arbeiten gezeigt von: Carmen Kleykens Vidal, Ji Hyun Yoon, Marta Haladzhun, Bayaru Takshina, Ian Whillock, Gabriel Abi Saber dos Santos, Candid Rütter und Denis Połeć.
Büro für problematische Komposition
Do., 6. Juni, 20 Uhr, TONALi SAAL (Kleiner Kielort 3-5)
Das 2019 in Hamburg gegründete „Büro für problematische Komposition“ ist ein Kollektiv von Multimedia-Komponist:innen, Musiker:innen und Videokünstler:innen. Der zentrale Ansatz ihrer künstlerischen Arbeit ist es, Risiken einzugehen, Neues auszuprobieren und das Experiment in den Mittelpunkt zu stellen.
Neben den Mitgliedern des Kollektivs werden beim Blurred Edges Festival mehrere Gäste begrüßt: der Komponist Fergal Dowling (IE), die Geigerin Feilimidh Nunan (IE) sowie der Cellist Michael Heupel (GR). Die Multimedia-Komponist Aigerim Seilova (KAZ), Greg Beller (FR), Stefan Troschka (DE) und Xiao Fu (CN) des Kollektivs haben gemeinsam auf der Grundlage von Fergal Dowlings „Super Human“ eine 60-minütige Reihe von Klangkunstinstallationen und Live-Performances geschaffen. Diese Werke erforschen die Möglichkeit der individuellen und kollektiven Überwindung konventioneller Beschränkungen. Es entsteht eine klangliche Kunstinstallation, die von Fantasie, Überrealismus und der Erkundung des Unbekannten geprägt ist und das Publikum in eine neue, aufregende Welt der experimentellen Musik entführt.
Frederik Mathias Josefson
Fr., 7. Juni, 18 Uhr, ligeti zentrum (Veritaskai 1)
Im Rahmen des Artists in Residence-Programms des ligeti zentrums ist der schwedische Komponist Frederik Mathias Josefson eingeladen. In dem Konzert wird das Ergebnis seiner zweimonatigen künstlerischen Arbeit präsentiert.
Spannende HOOU-Lernangebote zu Multimedia-Kompositionen
- Das englischsprachige Lernangebot MUTOR beschäftigt sich mit Musiktechnologie. Es geht um Fragen wie: Wie nehmen wir Musik wahr?, Wie machen wir neue Klänge?, Wie kombinieren wir Klänge mit Bildern?, Wie bewegen wir Klänge im Raum?, Wie verfolgen wir die Bewegungen und Gesten von Interpreten? und vieles mehr.
- Das Projekt „Extended Realities“ bietet eine Einführung in technische und künstlerische Werkzeuge zur Erstellung von interaktiven VR-basierten Werken. Im Fokus steht dabei einerseits die Entwicklung von Software Setups, welche eine Steuerung eines Avatar-Körpers ermöglichen, eine gezielte Interaktion mit Objekten sowie eine Verknüpfung mit anderen Programmen zum Beispiel zur Klangsynthese.
- Das englischsprachige Lernangebot „MusikApps-SunVox Tutorials“ richtet sich an alle Lehrkräfte, die die Grundprinzipien der elektronischen Musikproduktion in ihren Musikunterricht integrieren möchten, aber keine spezielle Ausbildung haben.
- Das englischsprache Lernangebot „Interactivity in classroom: visual programming“ ist für Musiklehrer:innen der Sekundarstufe mit Schülern zwischen 10 und 14 Jahren. Im ersten Teil des Kurses geht es um die Grundlagen der visuellen Programmierung in Pure Data. Im zweiten Teil des Kurses geht es darum, Daten von einem Gerät an einen Computer zu schicken, der Pure Data hostet. So kann man die Patches, die man im ersten Teil erstellt hat, steuern und in Instrumente verwandeln, mit denen man Musik machen kann.
Dan Bau beim Blurred Edges Festival

Das Bunte Luft Trio ist eine Improvisationsgruppe aus Hamburg, die sich auf die klanglichen Wechselwirkungen von Dan Bau, Baritonsaxophon und Modularsynthesizer spezialisiert hat.
Mi., 5. Juni, 20 Uhr, Migrantpolitan, Kampnagel, Jarrestraße 20
Jedes dieser Instrumente des Bunten Trios ist in völlig unterschiedlichen Genres verwurzelt, was die Musiker:innen als Sprungbrett nutzen, um ihren einzigartigen Sound zu kreieren. Tam Thi Pham (VN), Jana De Troyer (BE) und Jan Wegmann (DE) bringen ihre eigenen künstlerischen Hintergründe in die Gruppe ein und bewegen sich durch verschiedene Atmosphären. Diese musikalischen Reisen führen das Publikum von interplanetarischen Wüsten zu mikroskopischen Wäldern und bieten ein unvergleichliches Hörerlebnis.
So., 9. Juni, 18 Uhr, Hafenbahnhof, Große Elbstraße 276
Tam Thi Pham spielt die Dan Bau noch bei DIE DICKE TROMPETE. Das Festival schreibt dazu: „Weiter geht’s auf dem Weg zu einem Ladies Orchestra der freien Improvisation in Hamburg: anknüpfend an die lange Tradition der Damenkapellen laden Krischa Weber und Georgia Hoppe Kolleg:innen in den Hafenbahnhof ein. Die fünfte Soirée ist der grandiosen Bläser-Section aus „Manche mögen’s heiß“ gewidmet. Bei uns werden Saiten und Stimmbänder, Säge, Theremin und Reeds in freier Improvisation wild und mild schwingen. Wir mögen’s heiß und kalt, nur nicht lauwarm. Wir grooven uns ein für die Grande Soiree, der Reunion aller „Dicken Trompeten“, im September in der Christianskirche Ottensen.“
Lernangebot zu Dan Bau – ein Instrument mit nur einer Saite
Tam Thi Pham hat sich auch bei der HOOU mit dem spannenden vietnamesischen Instrument Dan Bau in einem Lernangebot auseinandergesetzt. Die Dan Bau hat nur eine Saite, erzeugt aber dennoch vielfältige Töne.
Experimentelle Musik beim Blurred Edges Festival
Das Trio IMAGO tritt beim Festival auf.
Fr., 7. Juni, 20 Uhr, HEART (Friedensallee 26)
Das experimentelle E-Gitarren-Trio mit Michael E. Haase, Manfred Stahnke und Georgia Ch. Hoppe unternimmt eine Wanderung über 18 Saiten in 60 Minuten. Das Festival kündigt das Event wie folgt an: „Unterwegs rechnen sie mit allerlei Unwägbarkeiten, denn jede Saite bietet zwar Halt, kann aber auch zum Stolperdraht werden. Die Unbe- rechenbarkeit, der stete Wechsel der Situation ist für die Wandernden jedoch gerade der Reiz. Denn hinter der nächsten Wegbiegung wartet schon Ungeahntes. Eine Rückkopplung, der Sägezahntiger oder Stille?“
Passende Lernangebote für dich zu dieser experimentellen Musik
- Improvisation – an introduction to its theory and practice
- a new composition for (e)guitar quartet
- Hear Between The Lines
- Microtonal Saxophone
Multimedia-Performance zu „Julia, Romeo and another social dilemma“
Das „ensemble.M“ präsentiert mit HOOU-Akteurin Xiao Fu in dieser neuen interdisziplinären Aufführung auf einzigartige Weise die emotionalen Erfahrungen des Einzelnen unter gesellschaftlichem Druck.
Mi., 12. Juni, 20 Uhr, Künstlerhaus FAKTOR (Max-Brauer-Allee 229)
Die Beziehung zwischen Liebenden und der Gesellschaft wird auf der Bühne in einen Kontext gesetzt, wobei die Grenzen der Liebe verschwimmen und von den Schatten der Gesellschaft umhüllt erscheinen. Diese Aufführung ermöglicht dem Publikum ein tieferes Verständnis dafür, wie gesellschaftliche Normen die emotionalen Entscheidungen des Individuums beeinflussen. Sie ist nicht nur eine nachdenkliche Darbietung, sondern auch eine tiefgehende Erforschung der komplexen Beziehung zwischen Liebe und Freiheit.
Xiao Fu hat auch ein HOOU-Lernangebot „fresh::sounds – Instrumente der Seidenstraße“ konzipiert. Dort findest du spannende Informationen über ganz besondere Instrumente.
Plattform für besondere Musik und Kunst
Wie du siehst, bietet sowohl das Blurred Edges Festival als auch die HOOU eine außergewöhnliche Plattform für besondere Musik und Kunst. Beide laden ein, neue Klänge zu entdecken, innovative Performances zu erleben und in eine kreative Vielfalt einzutauchen.

Bild: Thomas Panzau/altonale
29.05.2024 | hoouadmin
Die altonale in Hamburg: "Wir schaffen vielfältige Kulturerlebnisse, die Menschen verbinden"
Heike Gronholz ist die Geschäftsführerin der altonale, die zum ersten Mal in diesem Jahr mit der HOOU und den WATTwanderungen kooperiert. Im Gespräch erzählt die Kulturschaffende, was die altonale auszeichnet, welche besonderen Highlights das Festival bereithält und welche Themen bei dem Orga-Team jedes Jahr im Fokus stehen. Eines davon ist Nachhaltigkeit und Klimaschutz.
Und das ist auch ein Grund für die Kooperation. Denn die WATTwanderungen sind mit ihrem BioGAStmahl am 7. Juni Teil der altonale. Die Verantwortlichen um Axel Dürkop zeigen, wie sich selbst erzeugtes Biogas mit dem Fahrrad von Wilhelmsburg nach Altona bringen lässt. Es geht aber um viel mehr – nämlich um die Frage, ob sich auch in Altona eine Biogasanlage wie in Wilhelmsburg an den Zinnwerken etablieren lässt. Erfahrt nun mehr über die Hintergründe der altonale und was ihr am 7. Juni genau erleben könnt.
Was ist die Mission der altonale?
Heike Gronholz: Die Mission der altonale, das Festival der kulturellen Vielfalt, lässt sich in einem Satz formulieren: Wir schaffen vielfältige Kulturerlebnisse, die Menschen miteinander verbinden. Dabei geht es uns darum, inspirierende und berührende Momente mit den Veranstaltungen auszulösen, die nachhaltig wirken und neue Sichtweisen eröffnen. Dabei sind für uns diese Werte entscheiden:
- kulturelle Vielfalt aufzeigen,
- Partizipation ermöglichen,
- ökologische und soziale Verantwortung übernehmen,
- das Miteinander stärken und
- bewegende Begegnungen schaffen – im sozialen wie auch künstlerischem Sinne.
Wir haben ein Ziel: auf Augenhöhe mit dem Publikum und den Künstler:innen für und mit dem Stadtteil agieren. Das macht den einzigartigen, zugewandten Spirit der altonale aus.

Wie hat sich die altonale seit ihrer Gründung entwickelt und was sind die Highlights ihrer Geschichte?
Heike Gronholz: Die Highlights sind vielfältig. Die altonale feiert in diesem Jahr 25-jähriges Bestehen. Die Stärke der altonale liegt in ihrer von Anbeginn an eingeschriebenen Wandel- und Veränderbarkeit. Keine altonale gleicht der anderen. Im Jahr 1999 hat sich Festival gegründet. Es wurde aus dem Stadtteil heraus unter Beteiligung zahlreicher ansässiger Geschäfte, Unternehmen, Organisationen und Anwohner:innen ins Leben gerufen. Eine bunte Mischung aus Akteur:innen, die gemeinsam den Wunsch hatten, ihren Stadtteil zu stärken und ein Straßenfest zu feiern.
Nach anfänglichen Startschwierigkeiten war das Fest bereits im zweiten Jahr sehr erfolgreich: Es wurden 100.000 Besucher:innen gezählt. Was als überschaubares Straßenfest begann, hat sich zu einem der größten Kulturfeste in Norddeutschland etabliert und nun ist die altonale DAS Festival der kulturellen Vielfalt in der Region geworden.
In 2010 kam die Ausrichtung eines weiteren Festivals für Performances im öffentlichen Raum hinzu, das STAMP-Festival. Ein Festival im Festival. Diese Kunstform, die interventionistische Bespielung urbaner Räume, ist der altonale ein besonderes Anliegen. Öffentliche Räume, wo die Menschen schon sind. Ein Programm aus nahezu allen Kultursparten, wie Bildende Kunst, Literatur, Musik, Film und Theater, wurde in Ergänzung zum Straßenfest geschaffen. Für die Darbietungen wurden außergewöhnliche Räume im Stadtteil gesucht wie leerstehende Lagerhallen, Friseursalons, private Wohnzimmer und vieles mehr. Die Nutzung bestehender, häufig auch nicht-kulturaffiner Räume im Stadtteil, zeichnet das Festival aus.

Wie prägt die altonale den Stadtteil und welche Bedeutung hat sie für das kulturelle und politische Leben in Hamburg?
Heike Gronholz: Ich denke, die altonale hat eine ganz besondere Bedeutung erlangt. Sie ist Modellprojekt für andere Stadtteile oder Städte – besonders in Bezug auf ihre immer schon partizipative Ausrichtung. Lange bevor das Thema „Teilhabe“ en vogue wurde, hat sich die altonale damit beschäftigt, Formate zu entwickeln, die das Publikum beziehungsweise die Menschen im Stadtteil beteiligen und einbinden.
Als Beispiel sei ihr „ALTONA MACHT AUF“ zu nennen – ein Projekt, das von der „theater altonale“ kuratiert und organisiert wird. Bei diesem Projekt studieren Anwohnende etwas Künstlerisches ein und performen es von ihren Balkonen oder aus ihren Fenstern heraus. Es werden Rundgänge zu den teilnehmenden Balkonen und Fenstern organsiert. Dadurch lernen Nachbarn ihre Nachbarn auf ganz neue Art und Weise kennen. Das Format ist seit Jahren äußerst beliebt.
Die jährlich wechselnden europäischen Partnerstädte der altonale haben uns zum Beispiel schon mehrfach nach den Gelingensfaktoren dafür gefragt. Die Stadt Hamburg begegnet der altonale mit viel Wertschätzung für unsere einzigartige Ausrichtung. Für uns gilt in gewisser Weise immer noch der Slogan „Kultur für alle“. Das bedeutet, dass die Teilhabe der Menschen im Mittelpunkt steht. Und das wollen wir auch in Zukunft noch vertiefen: aus Konsument:innen Teilhabende zu machen. Es gibt bei uns keinen festen Eintrittspreis. Für alle rund 180 bis 200 Veranstaltungen gilt „Pay What You Want“.
Außerdem prägen die jeweils aktuellen gesellschaftlichen Geschehnisse das jeweilige Programm. Das zeigt sich zum Beispiel in unserem jährlich wechselnden Schwerpunktthema. Dieses Jahr haben wir das Motto „Transparenz“, 2023 war es „Umbruch“. Wir haben in den vergangenen Jahren verstärkt öffentliche und gesellschaftliche Diskurse aufgegriffen und dafür Gesprächsformate geschaffen. Der Titel dafür ist „altonale Salon“.

Inwiefern spielt Nachhaltigkeit eine Rolle bei der Gestaltung und Durchführung der altonale?
Heike Gronholz: Nachhaltigkeit ist DAS Querschnittsthema der altonale. Es zieht sich durch alle Bereiche und die gesamte Festivalstruktur. Seit etwas 15 Jahren hat es sich Schritt für Schritt zu einem immer bedeutenderen Element entwickelt. Die Mitwirkenden der altonale haben ein gemeinsames Verständnis dafür entwickelt. Es hat lange gedauert, Nachhaltigkeit nicht mehr als ein aufwendiges Nischenthema anzusehen, sondern einzubinden. Den Durchbruch dafür haben wir vor drei Jahren erlangt. Wir haben die Nachhaltigkeitsziele auf uns appliziert. Sind in der Betrachtung des Themas von uns ausgegangen, von unserer Expertise, von dem, was wir schon machen. So wurde es in die entsprechenden Schnittstellen eingeführt, von unten nach oben.
Wir haben uns kleine, leichter erreichbare Ziele gesetzt und jährliche Fokusthemen abgestimmt, wie zum Beispiel Mobilität oder Energie. Das wiederum wird unter vier Gesichtspunkten beleuchtet: sozial, künstlerisch, ökologisch und ökonomisch.
Vor welchen Herausforderungen steht die altonale und wie begegnet das Organisationsteam diesen?
Heike Gronholz: Eine große Herausforderung besteht darin, dieses wesentliche Thema kontinuierlich, über das gesamte Jahr hinweg, zu behandeln. In diesem Jahr konnte wir die dafür eingerichtete Stelle nicht mehr finanzieren, die dafür notwendige Förderung konnte nicht wieder generiert werden. Ein großer Verlust. Es bedarf einer Person, die die Fäden zieht und zusammenhält – und vor allem auch die Kommunikation übernimmt, nach außen und innerhalb des gesamten Teams. Wir merken dieses Jahr, wie schwer es uns fällt, die Bälle zum Thema in der Luft zu halten. Die Entlastung durch eine dafür verantwortliche Person ist unverzichtbar, sowohl das Thema als auch unsere Festivalstruktur ist zu vielschichtig.
Welche Anekdoten oder Momente in der Geschichte der altonale unterstreichen die Einzigartigkeit dieses Events?
Heike Gronholz: In der gesamten 25-jährigen Geschichte gibt es sicher unzählige bemerkenswerte Momente. Ich bin selbst erst seit 2016 dabei, aber mittlerweile auch schon acht Jahre. Ich kann nur von meinen Erfahrungen sprechen. Von den insgesamt über 60 Mitwirkenden (inklusive Produktionshelfer:innen und ehrenamtlich Tätigen) würden sie ganz unterschiedliche Anekdoten hören. Meine ist kurz erzählt: Ich stehe am Festivalzentrum im Park am Platz der Republik und eine junge Frau und ihr Mann kommen auf mich zu. Sie strahlen mich an und erzählen mir, dass sie in der Nähe des Parks wohnen und sich wochenlang auf die altonale gefreut haben – auf das ungezwungene, leichte Zusammensein mit anderen, auf das entdeckungsreiche Programm und auf viele überraschende Momente, die sie berühren und ins Gespräch bringen. Ich sehe die beiden seit fünf Jahren immer wieder, immer mit diesem Strahlen im Gesicht.
Auf welche Weise trägt die altonale zur kulturellen Vielfalt Hamburgs bei?
Heike Gronholz: In allem, was wir tun – wir sind ja DAS Festival der kulturellen Vielfalt. Unser Programm setzt sich aus allen Genres zusammen, unsere außergewöhnlichen Spiel- und Aufführungsorte sind über den gesamten Stadtteil verteilt, unsere Künstler:innen kommen sowohl aus Altona und Hamburg als auch aus unterschiedlichen europäischen Ländern (lokal und zugleich international). Unsere Netzwerk- und Kooperationspartner:innen sowie Sponsor:innen setzen sich aus vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen und Unternehmen zusammen. Hier einige Zahlen dazu: 30 Unternehmen, die uns unterstützen, 150 Partner:innen (NGOs und Vereine). Unser Publikum kommt aus Altona, ganz Hamburg und dem Umland – es ist so vielfältig wie der Stadtteil selbst. Am Festivalzentrum sind alle Altersstufen vertreten. Unser Kernteam ist mittlerweile recht divers – aber es gibt natürlich immer Luft nach oben.
Wie hat sich die altonale im Laufe der Jahre verändert und angepasst, um gesellschaftliche Entwicklungen zu reflektieren?
Heike Gronholz: Wir haben diskursive partizipative Formate entwickelt, zum Beispiel im vergangenen Jahr mit der Geheimen Dramaturgischen Gesellschaft. Wir führen öffentliche moderierte Gespräche mit Aktivist:innen wie Kübra Gümüsay oder Buchautor:innen wie Hendrik Cremer zu seinem jüngst veröffentlichten Buch „Je länger wir warten, desto mehr Mut werden wir brauchen. Wie gefährlich die AfD wirklich ist.“
Vor Corona hatten wir eine Art World-Cafe im Thalia in der Gaußstraße. Dort haben wir auf Augenhöhe mit den Gästen Unterthemen unseres jeweiligen Mottos diskutiert wie Grenzen oder Reichtum. Unser Jahresmotto spornt uns an und zieht sich wie ein roter Faden durch viele Programmpunkte.
Welche gesellschaftlichen Entwicklungen waren besonders prägend?
Heike Gronholz: Corona war natürlich prägend – und alle derzeitigen Krisen beschäftigen uns sehr. Allem voran die Umweltzerstörung und auch ganz besonders der erstarkende Populismus und Rechtsextremismus sowie die autokratisch geführten Regierungen in Europa und weltweit. Hinzu kommen der unfassbare Ukraine-Krieg und die heftige Radikalisierung des Nahost-Konfliktes. Es ist der immer weiter aufkeimende Rechtsextremismus, der uns antreibt, uns für eine freiheitliche und parlamentarische Demokratie, wie wir es nur irgendwie können, einzusetzen. Wir sind von Beginn an Teil der Initiative DIE VIELEN und aktuell ihrer Kampagne „Shield and Shine“. Angesichts der Wahlen in Europa und im Bezirk am 9. Juni haben wir uns der Bewegung „GoVote“ angeschlossen. Wir nehmen mit unserem Programm direkt Bezug auf die politische Situation.

Wie geht die altonale mit der Digitalisierung um und welche neuen Formate sind daraus entstanden?
Heike Gronholz: Während Corona im Jahr 2021 ist eine komplett neue Streaming-Produktion entstanden: altonale circus digital. Das war Performance, Interview, Musik aus der Küche, Gespräch über die deutsch-dänische Grenze hinweg, Kunst aus dem Wohnzimmer, Superheld:innen, Astronaut:innen und ein Hai, der durch einen brennenden Reifen sprang. Mit diesem neu entwickelten und inszenierten Format sind wir für uns ungewohnte digitale Wege gegangen: An acht Abenden wurde eine 60-minütige, eigenproduzierte und außergewöhnliche Show mit sehr tollen Talkgästen im Streaming-Format ausgestrahlt. Die Show bestand aus wiederkehrenden Elementen und Leitmotiven, wie kurzen VoxPop-Clips zum Thema „Systemrelevanz“, Beiträgen der altonale-Kultursparten und Interviews zu aktuellen kulturellen und sozialen Themen.
Diese Produktion hat uns um so viele Erfahrungen reicher gemacht und vieles, technisch als auch inhaltlich, gelehrt – auch, was es bedeutet, zu „scheitern“. Die Produktion war gut und schlecht zugleich und deswegen wieder gut. Eine irre Erfahrung.
Gibt es Partnerschaften oder Kooperationen, die für die altonale besonders fruchtbar waren oder neue Impulse gesetzt haben?
Heike Gronholz: Ja, zum Beispiel die Kooperation mit foodsharing e.V., Fridays for Future, GREEN EVENTS Hamburg, SoliSolar e.V., KEBAP Energiebunker, Amnesty Hamburg, Ecomove International e.V., Christianskirche, Thalia Theater Gaußstraße, Altonaer Museum, Lichtmeß-Kino, Stadtkultur Hamburg e.V., Clubkombinat Hamburg e.V., Kurzfilmfestival Hamburg, HfbK Hamburg und natürlich mit der HOUU… Mit vielen dieser Institutionen verbindet uns eine langjährige Zusammenarbeit. Wir haben Projekte gemeinsam erarbeitet, Formate ins Leben gerufen sowie Inhalte und Veranstaltungen ausgetauscht.

Am 7. Juni findet ein Event statt, das die altonale mit den WATTwanderungen der HOOU verbindet. Worum geht es genau?
Heike Gronholz: Wir freuen uns immer über neue Kooperationen wie im Juni mit der HOOU und den WATTwanderungen. Das Thema Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen, so dass wir direkt begeistert von der Initiative der BioGAStmahle waren. Darum laden wir zum Parkour für eine bessere Welt ein. Mit einem Fahrrad-Korso, bei dem wir eigens produziertes Biogas in Säcken von Wilhelmsburg nach Altona bringen, und einem anschließenden BioGAStmahl. Außerdem gibt es künstlerische Interventionen und vieles mehr! Gemeinsam mit den Besucher:innen und vielen Freiwilligen schnibbeln wir ein Festmahl aus geretteten Lebensmitteln und kochen zum ersten Mal mit Biogas. Und es gibt eine zukunftsweisende Vision: Wie wäre es, eine nachbarschaftlich betriebene Biogasanlage in Altona zu betreiben? Was in Wilhelmsburg gelingt, würde doch auch nach Altona passen! Es wird also spannend am 7. Juni.
Du interessierst dich für die WATTwanderungen der TU Hamburg und der HOOU und möchtest auch wissen, was es mit dem BioGAStmahl im Rahmen der altonale auf sich hat? Dann findest du auf wattwanderungen.hoou.tuhh.de alle Informationen.

Bild: Startschuss zur OER-Policy von sOER Frank unter Lizenz CC 0
05.04.2024 | hoouadmin
OER-Policy Kit als Leitfaden: So verankerst du OER an Hochschulen
Wie schreibe ich eine OER-Policy für meine Hochschule? Eine Arbeitsgruppe bestehend aus twillo, dem Netzwerk ORCA.nrw und der HAWK Hildesheim/Holzminden/Göttingen haben ein OER-Policy Kit für Hochschulen erstellt, das Orientierung beim Schreiben einer OER-Policy geben soll. In diesem Gastbeitrag erklären sie, was es damit auf sich hat.
Stelle dir vor, es findet eine Party statt und die Gastgeberin oder der Gastgeber verschickt keine Einladungen. Woher sollen die Gäste wissen, dass es eine Party gibt? Was sollen die Gäste mitbringen, was kann man erwarten? Wenn sich eine Hochschule für Openness in Studium und Lehre aussprechen und dadurch die Sichtbarkeit der Lehre stärken möchte, wenn sie Maßnahmen zur Förderung offener Bildungsmaterialien (OER) etablieren und eine Kultur des Teilens mit Lehrenden und Hochschulangehörigen „feiern“ möchte, wie können dann die Zielgruppen offiziell dazu eingeladen werden?
OER-Policy: Nicht nur das Vorhaben formulieren, sondern auch die Ausgestaltung
Mit einer OER-Policy können Hochschulen ein Zeichen für Openness setzen und die Förderung von OER strukturell verankern. Viele Hochschulen im DACH-Raum haben bereits eine OER-Policy auf den Weg gebracht, um nicht nur zu zeigen, dass sie sich für OER, Openness und eine Kultur des Teilens einsetzen, sondern auch wie sie diese Ziele mit welchen Maßnahmen an der Hochschule erreichen möchten.
Der Weg zu einer OER-Policy und ihre Ausgestaltung ist dabei so unterschiedlich und vielfältig wie die Hochschullandschaft selbst. Wenn sich eine Hochschule auf den Weg zu einer OER-Policy machen möchte, gibt es immer wieder ähnliche Fragen, zum Beispiel: Wo und wie fange ich an? Was soll die Policy enthalten bzw. regeln? Was ist aus rechtlicher Sicht zu beachten? Welche Akteur:innen müssen einbezogen werden?
Erfahrungen von Hochschulen zusammengetragen
Klar definierte Antworten auf diese Fragen gibt es kaum, aber es gibt Erfahrungen, wie Hochschulen diese Fragen individuell für sich beantwortet haben. Diese sind nun in Form eines OER-Policy Kits von einer Arbeitsgruppe bestehend aus twillo, dem Netzwerk ORCA.nrw und der HAWK Hildesheim/Holzminden/Göttingen übersichtlich und interaktiv zusammengestellt worden. Über einen Zeitraum von sechs Monaten hat die sechs-köpfige Arbeitsgruppe Erfahrungen von Hochschulen zusammengetragen, die bereits eine OER-Policy veröffentlicht haben oder noch mittendrin stecken.
Die Idee einer interaktiven Handreichung wurde schnell geboren, da die Vielzahl an unterschiedlichen Entwicklungsprozessen kaum in einer linearen Struktur unterzubringen ist. Während des Schreibprozesses wurden unter anderem auch Rückmeldungen aus Vernetzungstreffen von Policy-Aktiven eingeholt und eingearbeitet.
Praktischer Wegweiser für den OER-Policy-Entwicklungsprozess
Das fertige OER-Policy Kit ist ein Handlungsleitfaden, der als praktischer Wegweiser durch den Dschungel des OER-Policy-Entwicklungsprozess dienen soll. Egal, an welchem Punkt eine Hochschule steht – ob man einen Vorschlag für einen Policy-Entwurf benötigt, einen partizipativen Prozess gestalten oder die Hochschulleitung erst noch über das Für und Wider einer OER-Policy aufklären möchte – das OER-Policy Kit versucht, trotz der vorhandenen Unterschiede zwischen Hochschulen eine allgemeine Orientierung, konkrete Tipps und Beispiele sowie hilfreiche Materialien zu den verschiedenen Stationen zu geben.
Podcast gibt weitere Einblicke
Wenn du also gerade eine Openness-Party an deiner Hochschule planen und die Einladungskarten dazu gestalten möchtest – dann wirf gerne einen Blick in das OER-Policy Kit. Alle Dateien zum Nachnutzen des Policy Kits finden sich in diesem Git-Repository.
Psst: Eine Party ist nichts ohne guten Sound! Höre also auch gerne mal rein in die Podcastfolge „How To OER Policy“ des Podcasts „zugehOERt“ auf OERinfo oder Spotify, welche einen Einblick in die Hintergründe und Entwicklungsschritte des OER-Policy Kits gibt.
Nächstes Netzwerktreffen mit Expert:innen
Und was passiert nach dem Beschluss einer OER-Policy? Dazu findet am 9. April 2024 das nächste OER-Policy Netzwerktreffen von twillo statt – diesmal mit den Expert:innen Martin Ebner (TU Graz) und Simona Koch (UB Duisburg-Essen) zum Thema “Beyond OER-Policy”. Gerne anmelden!

Bild: Gerd Altmann auf Pixabay
08.03.2024 | hoouadmin
HAW-Projekt "Cooperate!": So arbeiten wir konstruktiv und kooperativ im Team
In dem Lernangebot „Cooperate!“ können die Teilnehmenden lernen, wie sie im Team reflektiert miteinander umgehen. Das Projekt wird Ende 2024 frei zugänglich sein.
Die Arbeitswelt verändert sich stetig und immer schneller. Wie können wir dieser zunehmenden Komplexität und diesen neuen Herausforderungen begegnen? Das Projekt „Cooperate!“ der HAW Hamburg erstellt dazu ein betriebswirtschaftliches Planspiel als Open Educational Resources unter offener Lizenz.
Dabei sollen projektbezogene Kooperationen der Teilnehmenden trainiert und reflektiert werden. Die Teilnehmenden lernen, kooperativ und konstruktiv zu arbeiten sowie reflektiert miteinander umzugehen. Sie verbessern damit ihre Handlungskompetenz in unvertrauten, dynamischen Umgebungen.
Interdisziplinäre und interkulturelle Vielfalt als Bereicherung
In dieser Umgebung können Menschen erlernen, wie mit interdisziplinärer und interkultureller Vielfalt im Team erfolgreich und zielorientiert kooperiert werden kann. Auf der HOOU-Plattform sollen am Ende im Sinne von Train-the-Trainer Materialien in Form von Manuals für die Lernbegleitung erstellt werden. Dabei hat das Projekt die Entwicklung, Dokumentation und Durchführung eines kollaborativen interdisziplinären Lehr- und Lernkonzepts zum Ziel. Ergänzt wird dieses durch ein projektbezogenes Planspiel, das den praktischen Rahmen bildet.
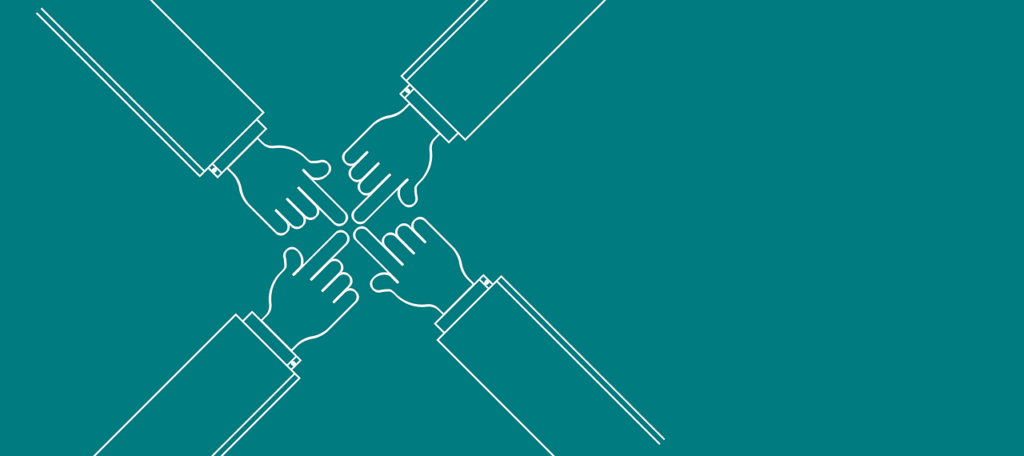
Nach der Bearbeitung des Planspiels sollen die Nutzenden verschiedene Teilkompetenzen verbessern und festigen können:
- Personale Kompetenz: Fremdsprachenpraxis, Flexibilität, Umgang mit Unsicherheit, Verbesserung der Initiativfähigkeit, Rollendistanz
- Soziale Kompetenz: unter anderem Kooperationsfähigkeit, Verbesserung des Empathievermögens in interdisziplinären und interkulturellen Kontexten, Metakommunikation, Synergiebildung in heterogenen Gruppen.
- Methodische Kompetenz: unter anderem Konfliktlösekompetenzen, Zeitmanagement in internationalen Kontexten, Reflexion/Thematisierung der Kulturbedingtheit von Handlungsstrategien usw.
Das Projekt wird im Dezember 2024 von den Verantwortlichen abgeschlossen und auf der HOOU-Plattform frei zugänglich für alle sein.
Text: Dorothee Wagner/HAW Hamburg

Bild: The Digital Artist/Pixabay
29.01.2024 | hoouadmin
Podcast schafft Bewusstsein für mehr Nachhaltigkeit in der Informatik
Wie kann die Informatik stärker Verantwortung in Sachen Nachhaltigkeit übernehmen? Das will der Podcast von Computer Science 4 Future mit interdisziplinären Expert:innen diskutieren.
Im Rahmen der Agenda 2030 wurden von den Vereinten Nationen im Jahr 2015 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals/SDGs) verabschiedet. In den SDGs wird nur eine nachhaltige Entwicklung als eine dauerhaft tragfähige Entwicklung betrachtet, die auf alle relevanten Dimensionen (Ökonomie, Ökologie und Soziales) und Ebenen (national, regional und lokal) ausgerichtet ist. Für den Bereich der Informatik und im Besonderen das Department Informatik an der HAW Hamburg geht es nicht nur darum, sich der eigenen Auswirkungen bewusst zu werden, sondern tatsächlich interdisziplinär zu Lösungen für globale Probleme beizutragen und damit Verantwortung zu übernehmen (vgl. HAW Hamburg). Hier finden sich weitere Informationen der Initiative Computer Science for Future.
Wie nimmt sich das Projekt Computer Science 4 Future dieser Thematik an?
In einer Reihe von Podcasts sollen die Themen Nachhaltigkeit und Netzpolitik von Studierenden des Department Informatik mit renommierten Gästen aus dem akademischen und industriellen Sektor besprochen werden. Die Informationen werden sorgfältig eingeordnet, kontextualisiert und einer kritischen Überprüfung unterzogen. Dieses akribisch kuratierte Material wird darüber hinaus als Ressource für andere pädagogische Veranstaltungen verfügbar gemacht, um die Qualität der Lehre im Allgemeinen zu verbessern.
Wie sind die Podcasts aufgebaut?
Jeder Podcast startet mit einer Einführung in das Thema, geht dann in die Vertiefung und letztlich in die praktische Veranschaulichung. Um das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und deren Bedeutung in das Zielpublikum zu tragen, ist es notwendig, den Zugang zu hochwertigen Lernangeboten zu Themen wie beispielsweise Green Computing, digitale Transformation oder ethische und soziale Aspekte der Informatik zu erleichtern und in den Podcast einzuweben.
Was ist das Ziel des Projekts?
Um zukünftige Generationen von sowohl technischen Expert:innen, als auch in der Informatikpraxis Tätige auf Nachhaltigkeit vorzubereiten ist eine breite Ausbildung erforderlich, die technische, soziale und ökologische Aspekte berücksichtigt. Die Vision ist es, einen alternativen Ansatz zur Vermittlung von Bildungsinhalten zu schaffen, der nicht nur das Lernen zugänglicher gestaltet, sondern auch den Zugang zu qualitativ hochwertigen Bildungsinhalten für eine breite Zielgruppe erleichtert. Der Podcast soll durch die Vermittlung von praktischen Informationen dazu anregen, das Thema zu vertiefen und sich mit den Grundlagen dafür beschäftigen.
Wer ist die Zielgruppe der Podcasts?
Der Podcast ist primär für Studierende der Informatik und angrenzender Disziplinen, aber auch Personen mit Interesse an Nachhaltigkeit und Technologie, im besten Fall auch technisch versierte Schüler:innen. Vorkenntnisse im Bereich Informatik sind von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich. Die einführenden Podcasts sollen so gestaltet werden, dass sie auch für Personen ohne technisches Vorwissen zugänglich sind.
Text: Dorothee Wagner/HAW Hamburg

Bild: SPOTSOFLIGHT/Pixabay
23.01.2024 | hoouadmin
Virtueller Studienführer? HAW Hamburg arbeitet an spannendem Chatbot
Können Chatbots im Studium helfen? Das erarbeiten aktuell die Projektverantwortlichen des Lernangebots ChAdmin der HAW Hamburg.
Chatbots begegnen uns schon seit vielen Jahren in unserem digitalen Alltag. Agierten sie anfangs noch als interaktive FAQ, lernen sie durch künstliche Intelligenz auch mehr und mehr auf komplexere Fragen Antworten zu finden. Ihnen allen ist gemein, dass nicht Mensch mit Mensch, sondern Mensch mit Computer interagiert. Aber wie werden Chatbots konzipiert und was ist die Technologie dahinter?
Wie funktioniert das Projekt ChAdmin?
Über projektorientiertes Lernen soll in dem Lernangebot ChAdmin der HAW Hamburg an die Funktionsweise von Chatbots herangeführt werden. Dabei geht es auf technischer Seite um die KI-basierte Technologie. Durch den niedrigschwelligen Zugang werden keine Vorkenntnisse benötigt.
Mit der konkreten Aufgabe, einen virtuellen Studienbegleiter zu erstellen, müssen die Themenfelder, zu denen der Chatbot auskunftsfähig sein soll, identifiziert und abgegrenzt werden. Darüber hinaus werden die rechtlichen, psychologischen, wirtschaftlichen, ethischen und weiteren wissenschaftliche Perspektiven auf den Einsatz von Chatbots vermittelt.
Einsatzmöglichkeiten für Chatbots identifizieren
Das Ziel des Projektes ist, dass die Nutzer:innen in der Praxis Einsatzmöglichkeiten für Chatbots identifizieren und etwaige Nebenwirkungen rechtzeitig bedenken können. Das Projekt hat die Vision, mit den konstruierten Chatbots und der großen Anzahl an Fragen und Antworten im Crowd-Ergebnis einen tatsächlich nutzbaren Studienbegleiter für die HAW Hamburg zu erstellen. Dadurch soll unter anderem auch ein Entlastungspotential für die Hochschulverwaltung ermöglicht werden.
Für Studierende im Erstsemester, aber auch im höheren Semester
Durch den niedrigschwelligen Einstieg in dieses komplexe Thema umfasst die Zielgruppe alle Studierenden der HAW Hamburg und Interessierte darüber hinaus. Das Lehrangebot wäre sowohl für Erstsemester als auch für höhere Semester einsetzbar. Es ist möglich, dieses im Studium einzusetzen, als auch im Selbststudium durchzuarbeiten. Die Projektverantwortlichen arbeiten aktuell an der Umsetzung des Lernangebots.
Text: Dorothee Wagner/HAW Hamburg

Headerbild: geralt/Pixabay
19.01.2024 | hoouadmin
Projekt AI.Lab: Starte eigene Experimente mit KI
Das Angebot AI.Lab der HAW Hamburg bietet einen Einstieg in die Künstliche Intelligenz. Es ist auch für Menschen ohne Programmierkenntnisse geeignet. Jede:r wird auf dem jeweiligen Wissenstand abgeholt.
Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde, aber wie die neuronalen Netze funktionieren, verstehen nur die wenigsten. KI hat immens vielfältige Anwendungsfelder und um diese einer breiten Masse von Menschen näher zu bringen, schafft das Projekt AI.Lab der HAW Hamburg ein niedrigschwelliges Lernangebot. Ganz ohne Installation soll es möglich sein, in die Welt der künstlichen Intelligenz einzutauchen und eigene Experimente durchzuführen. Das Ganze soll browserbasiert passieren, ohne einen eigenen Server für die sehr große Rechenleistung zu benötigen. Aktuell arbeiten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daran.
Projekt soll Hürden abbauen
Zum einen wird durch die Jupyter-Entwicklungsumgebung und Phyton als Programmiersprache, die beide quelloffen sind, ein Gegenpol zu kommerziellen Angeboten geschaffen. Zum anderen werden auch zivilgesellschaftliche Auswirkungen von Produkten wie Dall-E oder ChatGPT diskutiert. Mit dem Verständnis von neuronalen Netzen und maschinellem Lernen werden so auch die blinden Flecke dieser Anwendungen Stück für Stück abgebaut.
Zielgruppe sind Schulklassen
AI.Lab soll Interessierte ab den höheren Schulklassen ansprechen. Das Angebot bietet einen Einstieg für Menschen ohne Programmierkenntnisse und mit Programmierkenntnissen, um alle auf ihrem jeweiligen Wissensstand abzuholen. Dafür sollen sowohl Grundlagen-, als auch Vertiefungsmodule erstellt werden. Mit dem Abschluss des Moduls sind Lernende in der Lage, ihre eigenen Deep-Learning Applikationen zu bauen und in ihre Projekte einzubinden.
Das Projekt ist ab Dezember 2024 auf der HOOU-Plattform zu finden.
Text: Dorothee Wagner/HAW Hamburg

Headerbild: StockSnap/Pixabay
13.12.2023 | hoouadmin
Logik des Programmierens auf spielerische Art lernen
An der HAW Hamburg entwickeln Studierende unterschiedlicher Studiengänge ein multimediales Spiel. Mit diesem können sich Interessierte auf niederschwellige Art Programmierkompetenzen aneignen.
Programmiertechnische Kompetenzen gehören zu den Schlüsselkompetenzen der Zukunft. Wie können diese Fähigkeiten auf niedrigschwelliger Ebene zugänglich gemacht werden? Na ganz einfach: Let’s make it a game! Denn Spielen ist die natürlichste, universellste und kulturübergreifende Form des Lernens, wie auch Mitchel Resnick’s Life Long Kindergarten (1) gezeigt hat.
In einem interdisziplinären Team entwickeln nun Studierende der HAW Hamburg aus unterschiedlichen Studiengängen ein multimediales Spiel, das den Nutzer:innen ermöglicht, sich mit Hilfe der Open Educational Resources (OER) „Learning by Playing“, die Logik des Programmierens auf spielerische Weise anzueignen und komplexere Aufgaben erfolgreich zu meistern. Unter Nutzung von Unity als Engine und Entwicklungsumgebung soll das modular aufgebaute Spiel erweiterbar sein. Das Motto dieses projektorientierten Lernens ist „Einfach spielen – Challenges meistern – Kompetenzen erweitern!“.
Interesse an Information wecken
Die OER richtet sich an alle Menschen, die sich programmiertechnische Kompetenzen spielerisch aneignen möchten. Der niedrigschwellige Zugang zum Programmieren über das Spiel verfolgt das Ziel, das Interesse an Informatik zu wecken und den Spieler:innen Schritt für Schritt programmiertechnische Kompetenzen über das eigene Tun zu vermitteln.
Mit dem Durcharbeiten des Spiels beherrschen Lernende zentrale programmiertechnische Grundlagen im Bereich der Logik des Programmierens. Wir freuen uns auf das Lernangebot!
(1) Resnick, M. (2017). Lifelong kindergarten: Cultivating creativity through projects, passion, peers, and play. (S. 19 ff) MIT press.
Text: Dorothee Wagner/HAW Hamburg