
Insekten unterscheiden nicht zwischen Unkraut und von uns gepflanzten Blumen. Bild: Олександр К
20.05.2025 | Meena Stavesand
„Biodiversität beginnt vor der Haustür“ – Warum Artenvielfalt unser Überleben sichert
Ein funktionierendes Ökosystem liefert uns Luft, Wasser und Nahrung. Doch diese „Dienstleistungen der Natur“ geraten zunehmend aus dem Gleichgewicht. Zum Tag der biologischen Vielfalt (22. Mai) spricht Ivonne Stresius von der HAW Hamburg über Biodiversität und beantwortet unter anderem die Frage, was wir tun müssen, um sie zu erhalten.
Ivonne Stresius verantwortet das neue Lernangebot der HAW Hamburg „Biodiversität in Gewässern“, das aufzeigt, warum biologische Vielfalt wichtig ist und was sie mit dem Menschen zu tun hat. Außerdem gibt es noch ein weiteres interessantes Angebot. Die HAW Hamburg organisiert einen Zeichenkurs zu „Nature Journal“. Die Vielfalt der Natur können wir nämlich ganz einfach selbst erleben, indem wir nach draußen gehen und unsere Entdeckungen in einem eigenen „Nature Journal“ festhalten.
Damit das gut klappt, bietet die HAW Hamburg diesen Onlinekurs an, bei dem ihr lernt, wie ihr mit einfachen Zeichenmethoden Pflanzen und Tiere beobachten und künstlerisch dokumentieren könnt. Raus aus dem Hörsaal, rein in die Natur – und mit Farben zurück!
Und nun erklärt uns Ivonne Stresius, was Biodiversität ist, warum sie für unser Leben wichtig ist und was wir dafür tun können.
Was bedeutet Biodiversität?
Ivonne Stresius: Der Begriff setzt sich aus „Bio“ für Leben und „Diversität“ für Vielfalt zusammen. Man kann ihn daher mit „biologischer Vielfalt“ übersetzen. Dabei geht es nicht nur – wie oft angenommen – um Artenvielfalt, sondern um drei verschiedene Ebenen:
Zuerst die Artenvielfalt: Das ist die Vielfalt an unterschiedlichen Tier- und Pflanzenarten, Pilzen und Bakterien. Ziel ist es, viele verschiedene Arten zu haben, z.B. bei Vögeln, bei Insekten, bei Säugetieren und anderen Lebewesen. Dabei ist es wichtig, dass diese Arten in die jeweiligen Lebensräume passen. Wenn in einem Fließgewässer in Schleswig-Holstein plötzlich ein Signalkrebs lebt, der dort nicht heimisch ist, spricht man nicht mehr von gewünschter Artenvielfalt. Invasive Arten zählen nicht im positiven Sinne dazu. Wichtig ist dabei auch die Verteilung der Arten im Lebensraum. Es bringt wenig, wenn sie sich nur auf eine Ecke konzentrieren und der Rest leer bleibt. Ein funktionierendes Ökosystem lebt von Ausgewogenheit und Vernetzung. Jeder Bereich im Lebensraum sollte besiedelt sein, damit die Arten sich gegenseitig ergänzen und stabilisieren können.
Dann gibt es die Vielfalt der Lebensräume selbst: Ein Bach etwa sollte nicht nur aus Steinen oder Sand bestehen. Auch Totholz kann dort liegen und bietet anderen Arten einen Lebensraum. Unterschiedliche Gewässer wie Bach und See unterstützen unterschiedliche Arten. Diese strukturelle Vielfalt ist entscheidend. Wenn wir natürliche Vielfalt erhalten wollen, müssen wir auch Raum dafür lassen. Oft wird reguliert, eingeebnet, ausgebaut. Dabei brauchen Arten solche natürlichen Unebenheiten für ihr Überleben.
Der dritte Aspekt ist die genetische Vielfalt innerhalb einer Art. Bei Schnecken sieht man viele Farbvariationen. Diese Unterschiede entstehen durch genetische Vielfalt, vergleichbar mit verschiedenen Haarfarben bei Menschen. Sie sorgt dafür, dass sich Arten an Veränderungen besser anpassen können. Diese Anpassungsfähigkeit ist in Zeiten von Klimawandel und Umweltveränderungen besonders wichtig. Wenn eine Art genetisch sehr einheitlich ist, kann eine Krankheit oder eine Klimaveränderung sie auslöschen. Vielfalt ist also auch ein Schutzmechanismus.
Insgesamt gilt: Je größer die Vielfalt, desto stabiler das Ökosystem. Wenn Bedingungen sich ändern, können manche Arten damit besser umgehen als andere. Das gilt auch für genetische Unterschiede innerhalb einer Art. Vielfalt bedeutet Resilienz. Und Resilienz bedeutet, dass ein System Krisen besser übersteht und schneller ins Gleichgewicht zurückfindet.

„Vielfalt bedeutet Resilienz. Und Resilienz bedeutet, dass ein System Krisen besser übersteht und schneller ins Gleichgewicht zurückfindet.“Ivonne Stresius, HAW Hamburg
Wie kommen invasive Arten wie der Signalkrebs überhaupt in unsere Gewässer?
Ivonne Stresius: Meist ist der Mensch daran beteiligt. Zum Beispiel werden Tiere aus einem Aquarium in die Natur entlassen. Auch andere Tiere werden ausgesetzt. Problematisch wird es, wenn solche Arten sich stark verbreiten und heimische Arten verdrängen. Dann spricht man von invasiven Arten.
Das ist nicht immer böse Absicht. Manchmal passiert es aus Unwissenheit oder Gedankenlosigkeit. Aber das Ergebnis ist das gleiche: Das natürliche Gleichgewicht wird gestört.
Warum ist biologische Vielfalt für uns Menschen so wichtig?
Ivonne Stresius: Ein funktionierendes Ökosystem liefert sogenannte „Ökosystemleistungen“. Das heißt: Die Natur arbeitet für uns. Pflanzen produzieren die Luft, die wir atmen. Gewässer reinigen sich selbst, wenn genug biologische Vielfalt vorhanden ist und die Gewässerqualität stimmt. Schadstoffe werden im Sediment zurückgehalten, das Wasser bleibt sauber. Insekten bestäuben unsere Nutzpflanzen. Ohne sie hätten wir keine Äpfel, keine Kirschen, keinen Raps. Manchmal sind nur einzelne Insektenarten für bestimmte Pflanzen verantwortlich. Fehlen sie, gibt es keine Bestäubung mehr. In China wird in einigen Regionen bereits von Hand bestäubt. Das ist mühsam und ineffizient.
Auch Fische, Holz, Nahrung – all das ist eine Leistung der Natur. Wenn die Vielfalt abnimmt, funktionieren diese Leistungen nicht mehr oder nur noch eingeschränkt. Diese Leistungen nehmen wir oft als selbstverständlich wahr, aber sie sind das Ergebnis komplexer Prozesse, die sich über Jahrmillionen entwickelt haben.
Gibt es aktuelle Beispiele für bedrohte Arten?
Ivonne Stresius: Das Insektensterben ist ja schon länger bekannt. Acht Prozent aller Insektenarten gelten als gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Bei Gewässermuscheln und -schnecken sind es sogar mehr als 50 Prozent. Teichmuscheln etwa werden immer seltener. Noch merken wir es nicht direkt. Aber im Ökosystem fehlen diese Tiere. Muscheln filtern Wasser, Schnecken zersetzen abgestorbenes Material. Das sind wichtige Aufgaben.
Solche Rückgänge bleiben lange unbemerkt, weil sie schleichend passieren. Aber die Auswirkungen sind langfristig gravierend. Wenn das Gleichgewicht kippt, ist es schwer, es wiederherzustellen.
Wird das Thema in der Gesellschaft genug wahrgenommen?
Ivonne Stresius: Es tut sich etwas, aber viel zu langsam. Der Begriff Biodiversität ist vielen Menschen nicht geläufig. In einer Umfrage der Europäischen Kommission von 2019 konnte nur etwa 41 % der Befragten erklären, was das ist. Beim Klimawandel ist das Bewusstsein größer, aber auch dort ist die Umsetzung schwierig. Bei der Biodiversität hängen wir noch weiter hinterher.
Dabei sind die Zusammenhänge sehr konkret und betreffen unser direktes Lebensumfeld. Es braucht mehr Aufklärung, mehr Projekte, mehr Kommunikation – und natürlich politische Rahmensetzungen.
Gibt es auch positive Entwicklungen?
Ivonne Stresius: Ja, im Kleinen. Schottergärten sind in vielen Bundesländern verboten worden. Immer mehr Menschen achten beim Gärtnern auf insektenfreundliche Pflanzen. Aber es ist noch zu wenig. Viele Pflanzen, die beliebt sind, bringen Insekten nichts: Der Sommerflieder etwa lockt zwar Schmetterlinge an, bietet aber keine Nahrung. Auch Forsythien oder gefüllte Rosen sehen schön aus, liefern aber weder Pollen noch Nektar.
Die gute Nachricht ist: Viele Menschen sind bereit, etwas zu tun, wenn sie erst einmal wissen, worauf es ankommt. Deshalb ist Bildung so wichtig. Und ein Garten ist ein idealer Ort, um anzufangen.
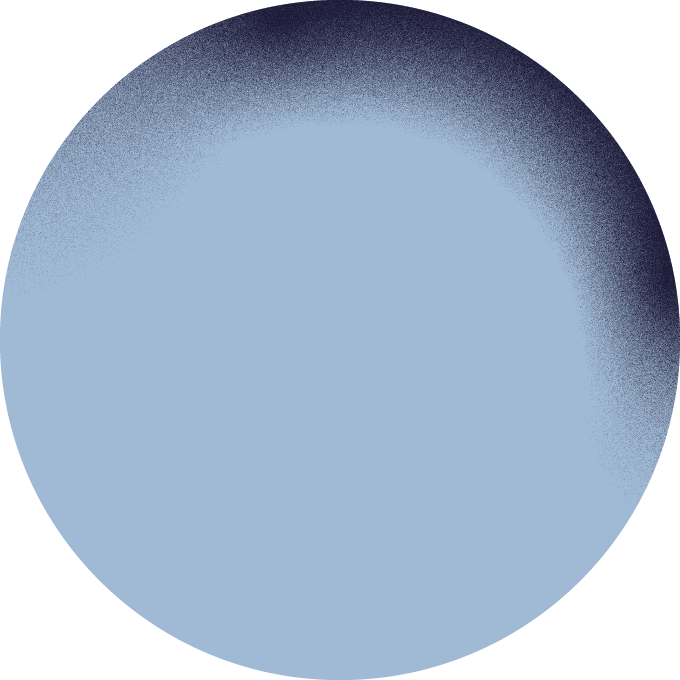
9 %
der Bienenarten gelten als gefährdet oder vom Aussterben bedroht.
Was können Gartenbesitzer:innen konkret tun?
Ivonne Stresius: Nicht alles muss ordentlich sein. Wildkräuter wie Giersch oder Brennnessel sind wichtige Lebensräume, zum Beispiel für Schmetterlingsraupen. Alte Pflanzenstängel stehen lassen, Totholz- oder Steinhaufen anlegen, nicht alles sofort wegräumen. Und: Mähfreier Mai! Also einfach mal den Rasen wachsen lassen oder zumindest nicht komplett mähen.
Keine Pestizide, kein Torf, mehr Struktur im Garten. Auch kleine Flächen haben Potenzial für mehr Vielfalt. Man sollte sich bewusst machen, dass jeder Quadratmeter Lebensraum sein kann, wenn er naturnah gestaltet ist. Das ist ein riesiger Hebel.
Was ist mit der Landwirtschaft?
Ivonne Stresius: Ein Großteil unserer Fläche wird landwirtschaftlich genutzt, oft konventionell. Pestizide, Monokulturen, fehlende Strukturen und zugeschüttete Kleingewässer zerstören Lebensräume. Die Ökosysteme können sich dort kaum erholen. Langfristig schadet sich die Landwirtschaft selbst: Der Boden wird unfruchtbar, Schädlinge breiten sich schneller aus, Erträge sinken.
Da ist ein großes Potenzial, aber die Landwirtschaft braucht Anreize und Unterstützung, um biodiversitätsfreundlicher zu wirtschaften. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
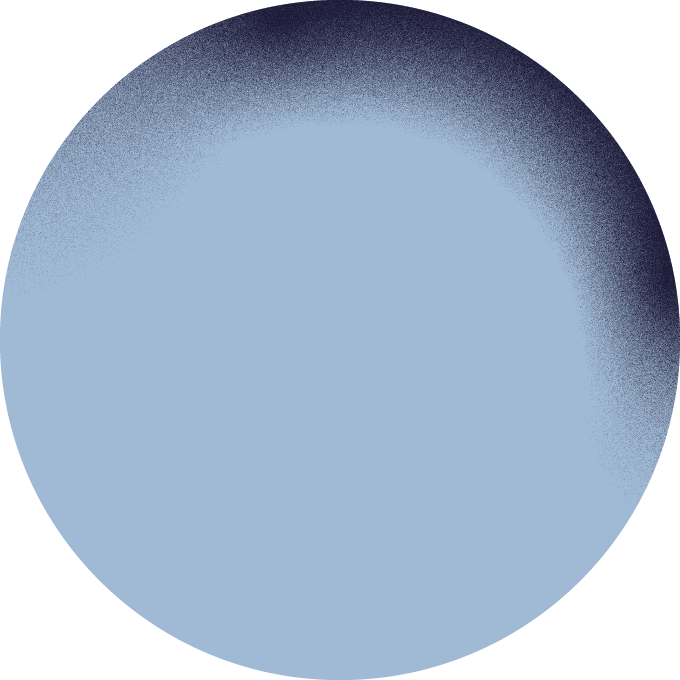
Über<br>50 %
der Gewässermuscheln und -schneckenarten sind gefährdet oder vom Aussterben bedroht.
Wie sieht die Zukunft aus, wenn sich nichts ändert?
Ivonne Stresius: Dann verlieren wir eine Ökosystemleistung nach der anderen. Vielleicht nicht komplett, aber es wird weniger. Statt 100 Fischen gibt es in Seen dann vielleicht nur noch 10. Statt vollen Ernten nur noch halbe. Und der Klimawandel verschärft alles.
Wir erleben eine schleichende, aber tiefgreifende Veränderung unserer Lebensgrundlagen. Und das ist nicht nur ein Thema für ferne Länder, sondern betrifft uns hier, vor Ort. Jetzt.
Was können wir tun?
Ivonne Stresius: Wir müssen verstehen, wie ein Ökosystem funktioniert. Es ist komplex und wir begreifen es noch nicht einmal ganz, aber zerstören es durch Unwissen. Bildung ist auch hier der Schlüssel. Jeder kann etwas tun. Und je mehr Menschen mitmachen, desto größer die Wirkung.

Biodiversität in Gewässern
Biodiversität in Gewässern - Was ist das und was hat das mit meinem Leben zu tun?
Ihr habt das Lernangebot „Biodiversität in Gewässern“ entwickelt. Es richtet sich vor allem an junge Menschen. Warum?
Ivonne Stresius: Junge Menschen tragen das meiste Risiko, wenn sich nichts ändert, und sie profitieren am meisten, wenn wir Biodiversität schützen. Das Angebot ist aber für alle Altersgruppen geeignet. Es soll Wissen niedrigschwellig vermitteln und Lust machen, selbst aktiv zu werden und sich mit der biologischen Vielfalt in der näheren Umgebung zu beschäftigen. Ob im Studium, im Alltag oder im eigenen Garten.
Haben Gärten wirklich so viel Potenzial?
Ivonne Stresius: Ja! Es gibt 17 Mio.Gärten in Deutschland. Wenn dort Vielfalt gefördert wird, ist das ein riesiger Gewinn für die Natur. Es müssen nicht immer große Flächen sein. Auch kleine Schritte zählen. Jeder Garten, der naturnah gestaltet ist, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und viele kleine Schritte ergeben am Ende eine Bewegung.
Über Ivonne Stresius

Ivonne Stresius ist Diplom-Umweltingenieurin (FH) und hat das Zweite Staatsexamen in Lebensmittelchemie. Seit 2006 arbeitet sie in der Forschung – unter anderem zu Partizipation, Stakeholder-Kommunikation sowie Gewässerqualität und Klimawandel in komplexen Umwelt- und Gesellschaftssystemen. Ihre weiteren Schwerpunkte liegen im Bereich Gesundheitsschutz im Zusammenhang mit der EG-Badegewässerrichtlinie. Ivonne Stresius ist darüber hinaus im Projektmanagement nationaler und internationaler Forschungsprojekte tätig, organisiert Workshops und Konferenzen und entwickelt Online-Lernangebote sowie pädagogische Formate rund um Natur und Mensch.